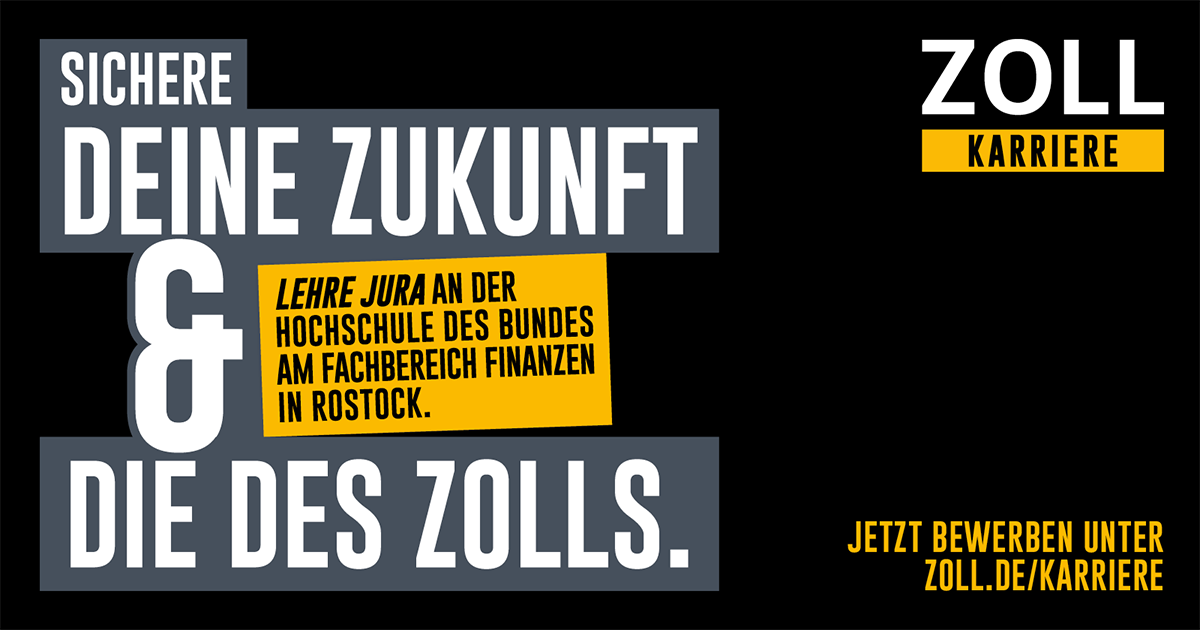Eigentlich sind noch nicht einmal 90 Tage vergangen, seit CDU-Chef Friedrich Merz das halbe Parlament – und nicht zuletzt seinen späteren Koalitionspartner SPD – gegen sich aufgebracht hat, indem er einen Forderungskatalog zur Migration mit Stimmen der AfD durchsetzte. Doch es kommt einem vor wie Dekaden.
Dieser Moment zeigte in schmerzhafter Deutlichkeit, wie sehr die Fluchtmigration zu dieser Zeit drohte, die Republik zu zerreiben. Nach der Wahl sind die Gemüter naturgemäß etwas abgekühlt, doch dafür steht nun eine ungleich schwerere Aufgabe an, als Entschließungen des Bundestags zu fordern: Union und SPD müssen ihrem gemeinsamen Versprechen, irreguläre Migration zu reduzieren, auch Taten folgen lassen.
Es geht um die Grenzen
Das Kapitel 3.3 des Koalitionsvertrags trägt noch den progressiven Titel "Migration und Integration", doch die zentrale Botschaft folgt nach nur wenigen Sätzen: "Die Anreize, in die Sozialsysteme einzuwandern, müssen deutlich reduziert werden. Wir werden Migration ordnen und steuern und die irreguläre Migration wirksam zurückdrängen." Hierzu finden sich in dem Papier, das Union und SPD künftig als Arbeitsgrundlage für ihre Regierung dienen soll, allerhand Maßnahmen.
So will man etwa den Amtsermittlungsgrundsatz in Asylverfahren gegen den Beibringungsgrundsatz austauschen, Regelausweisungen bei bestimmten Straftaten einführen oder Rechtsmittel in Asylsachen beschränken. Doch all das dürfte die Zuwanderung bzw. den Aufenthalt von Menschen ohne Bleiberecht in Deutschland allenfalls in homöopathischen Dosen reduzieren.
Zentral ist daher für das schwarz-rote Bündnis die Sicherung der Grenzen in Kombination mit Zurückweisungen. Darüber wurde auch vor der Wahl schon viel gestritten, weil Zurückweisungen an den Grenzen ohne vorherige Prüfung des Asylantrags nach Auffassung zahlreicher Fachleute rechtswidrig sind. Nun kann auch ein Koalitionsvertrag illegale Maßnahmen nicht legalisieren, weshalb der Streit weitergeht: Sind Zurückweisungen an den Grenzen zulässig oder nicht?
Grenzkontrollen sind möglich – aber wie lange?
Zunächst kann nur zurückgewiesen werden, wer auch entdeckt wird, und dazu braucht es Kontrollen. Diese sind im Schengen-Raum eigentlich nicht Teil des Plans, die Handelszone lebt schließlich von freiem Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten. Allerdings sieht der Schengener Grenzkodex (SGK) die Möglichkeit vor, Grenzkontrollen vorübergehend einzuführen, nach einer Anpassung im vergangenen Jahr sogar für bis zu zweieinhalb Jahre. Die nationalen Regierungen entscheiden darüber autonom und informieren die EU-Kommission lediglich über diesen Schritt. Einspruch aus Brüssel ist dabei eher nicht zu erwarten, meint der Migrationsrechtsexperte Daniel Thym von der Universität Konstanz: "Im Asylrecht klagt die Kommission praktisch nie."
Klingt also nach leichtem Spiel für die angehende Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag ankündigt, die aktuell bereits laufenden Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen so lange fortzusetzen, bis das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS) und die Dublin-Regeln wieder zu einem funktionierenden Außengrenzschutz führten (Rn. 2990 ff.). Ganz so unumstritten sind die juristischen Voraussetzungen für Grenzkontrollen allerdings nicht, müssen sie doch stets an eine bestimmte Gefahrenlage anknüpfen und dürfen nur eine begrenzte Zeit laufen. Als solche Gefahrenlage kommen zwar auch Migrationsströme prinzipiell in Frage. Art. 25 Abs. 1 SGK fordert aber "eine außergewöhnliche Situation, in der plötzlich eine sehr hohe Zahl unerlaubter Migrationsbewegungen von Drittstaatsangehörigen zwischen den Mitgliedstaaten stattfindet". Schon das könnte in der aktuellen Lage, in der eher weniger Geflüchtete nach Deutschland kommen als in den vergangenen Monaten und Jahren, schwer zu begründen sein.
Hinzu kommt ein anderes Problem, auf das der Freiburger Migrationsrechtler Constantin Hruschka hinweist. Er erinnert an eine kürzlich ergangene Entscheidung des VGH München, der schon die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze im Jahr 2022 für illegal hielt. Grund ist, dass diese Kontrollen bereits seit sechs Jahren laufen und immer wieder verlängert wurden. Es hätte aber zwischenzeitlich eines neuen Grundes bedurft, um sie zu verlängern, meinte der VGH. Dabei bezog er sich auch auf eine Entscheidung des EuGH, der ebenfalls festgestellt hatte, dass Grenzkontrollen nicht ohne Weiteres eingeführt und verlängert werden dürfen. "Der VGH hält die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze für eine Fortsetzung der Kontrollen seit 2015", erklärt Hruschka. Ohne neue Begründung sei das nicht mehr möglich.
Zurückweisungen in Dublin-System nicht vorgesehen
Ob rechtswidrige Grenzkontrollen auch rechtswidrige Zurückweisungen bedingen, ist nicht sicher. Hierbei handelt es sich schließlich zunächst einmal um zwei getrennte Verwaltungshandlungen. Aber auch so bestehen gegen die Zurückweisungen, welche Schwarz-Rot laut Koalitionsvertrag "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn" vornehmen will (Rn. 2988 ff.), erhebliche Bedenken unter Asylrechtlerinnen und Asylrechtlern.
Hier ist das Grundproblem: Die Dublin-III-Verordnung sieht zwar vor, dass diejenigen Länder für Asylgesuche zuständig sind, in welchen die Geflüchteten zuerst in die EU eingereist sind. Regelmäßig sind das Länder an der Ostgrenze, Spanien oder Italien. Deutschland, das keine EU-Außengrenze hat, bleibt davon also verschont. Doch das bedeutet nicht, dass Menschen, die – so die Realität – einfach nach Deutschland durchreisen, hier abgewiesen werden dürften. Denn das Unionsrecht sieht auch vor, dass ein Land – gleich welches – den Asylantrag der einreisenden Person prüfen und dabei zumindest die Zuständigkeit ermitteln muss. Erst dann kann sie in den zuständigen Staat überstellt werden. Das bedeutet aber mitunter monate- oder jahrelange Verfahren, während derer die Menschen im Land leben.
Aus diesem Grund können rechtlich einwandfrei nur solche Menschen zurückgewiesen werden, die bei ihrer Einreise keinen Asylantrag stellen – was die deutliche Minderheit sein dürfte. Folglich sieht auch Daniel Thym keine Grundlage für Zurückweisungen in großem Stil, es sei denn, man beriefe sich auf eine Ausnahmeklausel im EU-Recht. Art. 72 AEUV belässt nämlich den Mitgliedstaaten die Zuständigkeit für die "Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit". Könnte sich Deutschland, wie es u.a. aus der CDU mehrfach vorgebracht wurde, hierauf berufen?
"Es braucht keinen Staatskollaps"
An dieser Stelle wird es noch etwas kniffliger. Während Fachleute einwenden, dass sich eine Gefahr für die innere Sicherheit oder die öffentliche Ordnung nicht begründen lasse, weil die gegenwärtigen Migrationsströme den Staat nicht vor existenzielle Herausforderungen stellten, weist Thym darauf hin, dass die Begriffe der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung sehr dehnbar seien. "Das ist keine Notlagen-, sondern eine Ausnahmeklausel", so Thym. "Es braucht dafür keinen Staatskollaps." Auch systemische Probleme, wie eine Überlastung der Unterbringungs-Kapazitäten, könnte man ggf. darunter fassen. Die Ausnahmeklausel habe sich daher in der EU "zum neuen Lieblingsinstrument entwickelt", erklärt Thym. Auch Länder wie Österreich oder Polen hätten sich darauf berufen.
Hruschka hält dem entgegen, der EuGH habe bereits klargestellt, dass diese Ausnahme nach Art. 72 AEUV nur dann greife, wenn europäisches Primär- und Sekundärrecht keine ausreichende Grundlage böten, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Bereits 2017 sei der Gerichtshof im Fall Jafari der Meinung gewesen, dass das geltende Asylrecht ausreichend Instrumente bereithalte, mit denen Staaten auf große Migrationsströme reagieren könnten. Dass der EuGH bei den Zurückweisungen am Ende mitspielen wird, glaubt indes auch Thym nicht. "Den EuGH wird die Sorge umtreiben, dass ihm bei zu vielen Ausnahmen das europäische Asylrecht um die Ohren fliegt", so Thym. Der Gerichtshof werde die Zurückweisungen daher wohl nicht billigen.
Bundesregierung kalkuliert womöglich mit Abschreckungseffekt
Nach Ansicht Thyms ist die Verabredung im Koalitionsvertrag damit ohnehin nicht auf eine mittelfristige rechtssichere Lösung ausgerichtet, sondern auf einen kurzfristigen Abschreckungseffekt. Sollte ein solcher eintreten, so Thym, könne das der Bundesregierung ermöglichen, "die Zurückweisungen gesichtswahrend zu beenden, bevor zu viele Gerichte einschreiten". Ein kalkulierter Rechtsbruch also.
So oder so müsse man sich mit den Nachbarländern wie Österreich verständigen, betonen Thym und Hruschka unisono. Doch selbst wenn Österreich zustimmen würde, Migrantinnen und Migranten zurückzunehmen, die an deutschen Grenzen abgewiesen werden, machte das die Zurückweisungen auch nicht legal, da sind sich die Experten einig.
Und dann wäre da noch das "Dublin-Argument": Das Dublin-System funktioniere offenkundig nicht mehr, weshalb seine Regeln auch nicht mehr angewendet werden müssten, ist die Schlussfolgerung einiger Unions-Politikerinnen und -Politiker. Doch auch das wird den EuGH nicht überzeugen, glaubt Constantin Hruschka. Ziel von Dublin sei schließlich vor allem, das individuelle Recht auf Prüfung eines Asylantrags sicherzustellen.
Somit steht die angehende Koalition vor dem Dilemma, dass große Ankündigungen noch keine echte Wende bringen. Will sie nicht auch im politischen Tagesgeschäft von der Realität eingeholt werden, braucht sie also Antworten. Und die könnten in Europa liegen. Die Grenzkontrollen und die Aussetzung des Dublin-Systems sollen nämlich nur so lange gelten, bis man auf europäischer Ebene eine Lösung gefunden habe, versichern die Koalitionäre. Dazu will man die GEAS-Reform noch in diesem Jahr umsetzen. Doch damit das System funktioniert, wird es vor allem eines brauchen: europäische Zusammenarbeit.