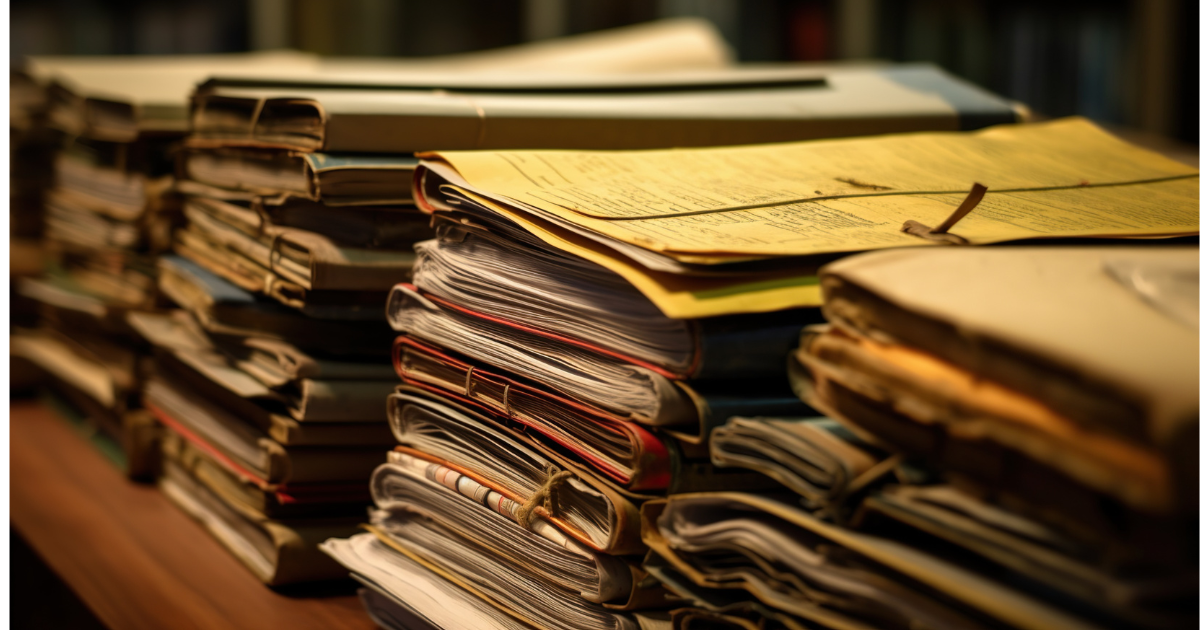Während sich Cannabis-Fans im ganzen Land am 1. April 2024 den ersten legalen Joint ansteckten, markierte der Tag für die Staatsanwaltschaften und Gerichte den Beginn einer Mammut-Aufgabe: die Umsetzung der im neuen Gesetz angelegten Amnestie-Regelung.
Bis zuletzt war nicht klar gewesen, ob das Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (CanG) wie geplant beschlossen werden würde. Einer der großen Kritikpunkte aus der Justiz: die geplante Amnestie, nach der alle verhängten – und noch nicht vollstreckten – Strafen zu erlassen sind, wenn die Tat nach neuer Rechtslage nicht mehr straf- oder bußgeldbewährt ist. Geregelt ist das in einem neuen Art. 316p EGStGB, der wiederum auf die generelle Amnestie-Regelung des Art. 313 EGStGB für Straftaten verweist, die bei Inkrafttreten einer Entkriminalisierung noch nicht vollstreckt sind.
Justiz und Vollstreckungsbehörden hatten im Vorfeld einen enormen bürokratischen und personellen Aufwand prognostiziert und auf die schiere Zahl der Altfälle hingewiesen, die erneut bearbeitet werden müssten. Richter- und Staatsanwaltsvereinigungen hatten vor allem im Bundesrat bis zuletzt versucht, mit ihren Bedenken Gehör zu finden. Doch so spät im Gesetzgebungsverfahren, noch dazu einem, das auf allen gesellschaftlichen Ebenen umstritten war, blieben sie erfolglos. Am 1. April trat die erste Stufe des CanG – das KCanG samt Amnestie-Regelung – in Kraft.
Das erste Problem: Betroffene Fälle identifizieren
Knapp zwei Monate später haben die Staatsanwaltschaften bundesweit laut Recherchen der ARD im Zuge der Cannabis-Amnestie mehr als 200.000 Aktendeckel gehoben. Tendenz steigend, denn der Umsetzungsprozess dauert in den meisten Bundesländern noch an. Waren die Sorgen der Justiz also begründet?
„Die Befürchtungen haben sich insoweit bewahrheitet, als wir allein hier in Berlin tatsächlich etwa 8.000 Fälle noch einmal in die Hand nehmen mussten, was schon einen großen Mehraufwand bedeutet hat“, sagt Anke Bittig von der Berliner Staatsanwaltschaft. Um die Amnestie zu stemmen, haben Rechtspfleger in enger Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung und den Dezernenten wochenlang nichts anderes getan, als Akten zu sichten.
Denn die erste Hürde bei der Umsetzung der Amnestie ist es, die betroffenen Altfälle überhaupt zu identifizieren. „Unsere IT-Abteilung hat eigens ein Abfrage-Modul entwickelt, um die Fälle zu finden“, berichtet Bittig. Trivial sei das nicht gewesen, das Aktenverwaltungssystem der Berliner Staatsanwaltschaft kam an seine Grenzen. „Das Modul musste immer wieder angepasst und optimiert werden. Zuerst haben wir nach Stichworten im Text der Eingangserfassung der Akte gesucht, aber das hat sich nicht bewährt. Da war zum Beispiel laut Akte ein Fall von § 30 BtMG, der aber dann doch nach § 29 BtMG verurteilt wurde.“ Später habe man sich darauf verlegt, die Mitteilungen an das Bundeszentralregister zu durchsuchen. „Man kann nie ausschließen, dass wir einen Fall übersehen haben. Wir sind nicht perfekt. Und es gab keine Zeit oder Möglichkeit, sich auf solch eine Abfrage vorzubereiten.“
In anderen Bundesländern kann man derweil von einer elektronischen Abfrage nur träumen. „Die Identifizierung war nur durch eine händische Überprüfung des Inhalts der jeweiligen Verfahrensakten möglich“, heißt es etwa aus dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz. „Da bei der Erfassung der Verfahren weder nach der Art noch nach der Menge des Betäubungsmittels differenziert wird, mussten alle Verfahren überprüft werden, bei denen eine Verurteilung nach §§ 29 ff. Betäubungsmittelgesetz erfolgt ist.“
Auch in Dresden wurde jede Akte händisch sortiert. „Eine Identifizierung der betroffenen Verfahren anhand der Datenbanken der Staatsanwaltschaft war nicht möglich“, erklärte die Dresdener Staatsanwaltschaft. „Zwei der insgesamt fünf Staatsanwälte der Vollstreckungsabteilung haben im Zeitraum März und April 2024 fast ausschließlich Verfahrensakten nach den Vorgaben des CanG geprüft und bearbeitet.“
Mischfälle: Was ist von der Amnestie betroffen?
Nicht jede Akte, die das Abfrage-Modul der Berliner Staatsanwaltschaft ausspuckt, ist aber automatisch ein Fall für die Amnestie. In vielen Bundesländern führen Rechtspfleger oder Vollstreckungsstaatsanwälte eine Vorprüfung durch und sortieren nach Fallgruppe und nach Priorität: Fahndungen und Haftsachen zuerst, Zweifelsfälle zum Schluss.
Denn auch die rechtliche Bewertung gestaltet sich zuweilen schwierig, ganz besonders, wenn es nicht nur um den – mittlerweile erlaubten – Cannabis-Besitz in kleinen Mengen geht. „Nur in wenigen Fällen kommt eine komplette Amnestierung in Frage“, berichtet Bittig. „Meistens handelt es sich um Fälle tatmehrheitlicher Begehung, die neu bewertet werden müssen, oder um Mischfälle.“ Gerade letztere führten in der Berliner Staatsanwaltschaft zu Debatten um die Frage, was von der Amnestie-Regelung überhaupt betroffen sei.
Zur Auffrischung: Hat eine Person mehrere Straftatbestände tatmehrheitlich erfüllt (§ 53 StGB) bildet das Gericht eine Gesamtstrafe. Diese muss dann – durch Herausrechnen der straflos gewordenen Tat – neu festgesetzt werden. Dafür muss das Gericht die verurteilte Person im Zweifel nochmal anhören. Der Beschluss kann im Wege der sofortigen Beschwerde angefochten werden.
Schwieriger sind jedoch Mischfälle, bei denen die Person einen oder mehrere Tatbestände tateinheitlich (§ 52 StGB) erfüllt hat. „Typische Beispiele für Mischfälle sind die, in denen der Täter nicht nur Cannabis, sondern auch noch Kokain in der Hosentasche hat“, erklärt Bittig. „Da sind wir so vorgegangen, dass wir ein oder zwei Akten als Testballons an die Gerichte geschickt haben, weil wir der Auffassung sind, dass das kein Fall der Amnestie ist.“ Erst wenn das Gericht einmal entschieden habe, folgten ähnliche Fälle.
Auch bei den gerichtlichen Zuständigkeiten gab es zunächst einige Unklarheiten. Müssen die Vollstreckungskammern ran oder die erkennenden Gerichte? Wie liegt ein Fall, in dem das Landgericht als Berufungsinstanz das Amtsgerichtsurteil abgeändert hat? Hier zieht Bittig aber eine positive Bilanz. „Wir mussten uns zwar quer durch das Bundesgebiet hangeln, aber die Gerichte haben gut mitgemacht und eilbedürftige Sachen auch dann übernommen, wenn sie der Meinung waren, gar nicht originär zuständig zu sein.“ Mittlerweile gibt es zur Zuständigkeit für die Amnestie sogar schon erste Rechtsprechung, an der sich auch die Staatsanwaltschaften orientieren können.
Es gebe auch Konstellationen, die vergleichsweise leicht zu bewerten seien, sagt Bittig. Trotzdem sei die Bearbeitung aufwändig. Nach der Vorprüfung durch den Rechtspfleger prüft die Staatsanwältin den Fall und stellt gegebenenfalls Anträge beim Gericht. Kommt die Akte zurück, muss sie eine Amnestieanweisung schreiben, die zentrale Schreibstelle, die Kostenbeamten und den Rechtspfleger einbeziehen. „Man darf auch nicht vergessen, dass wir hier einen Aktenlauf haben. Jede Akte muss etliche Stationen innerhalb der Geschäftsstelle passieren.“ Nicht nur die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hätten Arbeit mit den Fällen, sondern vor allem die Geschäftsstellen.
Sonderfall Jugendgericht
Auch im Jugendstrafrecht kommt die Amnestie-Regelung zur Geltung. Hier haben die Jugendrichterinnen und -richter aber eine Sonderrolle: Als Vollstreckungsleiter sind sie selbst für die Amnestie-Fälle zuständig. So auch Dr. Jessica Oeser, Jugendrichterin und Direktorin des Amtsgerichts Hamburg-Bergedorf: „Auf die Jugendsachen hat die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Vollstreckung keinen Zugriff. Die Richter überwachen die Vollstreckung selbst. Wir müssen für die Jugendsachen das machen, was die Staatsanwaltschaft für die Erwachsenensachen macht.“
Das gestaltet sich oft ebenfalls problematisch. „Im Jugendstrafrecht wird eine Einheitsstrafe gebildet, oft mit richterlichen Weisungen, wie etwa einer Drogenberatung“, erklärt Oeser. Vor allem bei der Abänderung einer richterlichen Weisung werde es arbeitsintensiv: Durch eine erneute Anhörung des Jugendlichen muss die Richterin feststellen, ob eine Maßnahme noch erzieherisch sinnvoll ist.
Im Gegensatz zu den großen Staatsanwaltschaften hatten Oeser und ihre Kollegen am Amtsgericht Bergedorf jedoch kein eigens programmiertes Abfrage-Modul zur Verfügung. „Es wurde relativ schnell klar, dass wir jede Akte nochmal durchgucken mussten“, erzählt die Richterin. „Wir haben zwar ein Aktenverwaltungsprogramm, das kann man aber nicht verlässlich alle relevanten Fälle rausfiltern. Also haben wir uns einen Zeitraum X vorgenommen, in dem es realistisch ist, dass die Strafen noch nicht komplett vollstreckt sind und eine lange Liste mit Fällen erstellt, die in Frage kommen. Und dann haben wir in stundenlanger Arbeit und unter beispiellosem Engagement der Geschäftsstelle und der Rechtspflegerin diese Liste abgearbeitet.“ Händisch mussten alle Aktenzeichen eingetippt und die Akten sortiert werden – selbst die Kostenbeamten und Protokollführer wurden dafür eingespannt.
Hoher Zeitdruck trifft auf angespannte Personalsituation
Im Ergebnis habe das Amtsgericht nur wenige Jugendsachen gefunden, die tatsächlich noch einmal bearbeitet werden mussten. Doch Oeser weist auch auf die ohnehin schon knappe Personaldecke in der Justiz, besonders aber in der Geschäftsstelle hin. Die merkliche Mehrarbeit treffe dort auf eine ohnehin angespannte Personalsituation.
„Ich bedauere es sehr, dass derart gravierende Gesetzänderungen mit so arbeitsintensiven Folgen vom Gesetzgeber mit einem derart engen Zeitplan versehen werden.“ Das Gesetz hätte auch eine Übergangszeit bis zum Inkrafttreten vorsehen können, doch der Gesetzgeber hat sich gegen eine solche Frist entschieden. Der Justiz sei die Möglichkeit genommen worden, ohne Zeitdruck die nötigen Vorbereitungen zu treffen. „Ich verstehe nicht, warum darauf keinerlei Rücksicht genommen worden ist.“
Auch Bittig von der Berliner Staatsanwaltschaft sieht in der Rückschau die größten Probleme in der angespannten Personalsituation. Insgesamt zieht sie aber eine positive Bilanz: „Wir waren recht sportlich und die Gerichte haben auch gut mitgemacht“, sagt sie. Alle hätten sich solidarisch gezeigt und eilbedürftige Fälle ohne Murren übernommen. „Trotzdem bin ich froh, dass das eine einmalige Sache war.“