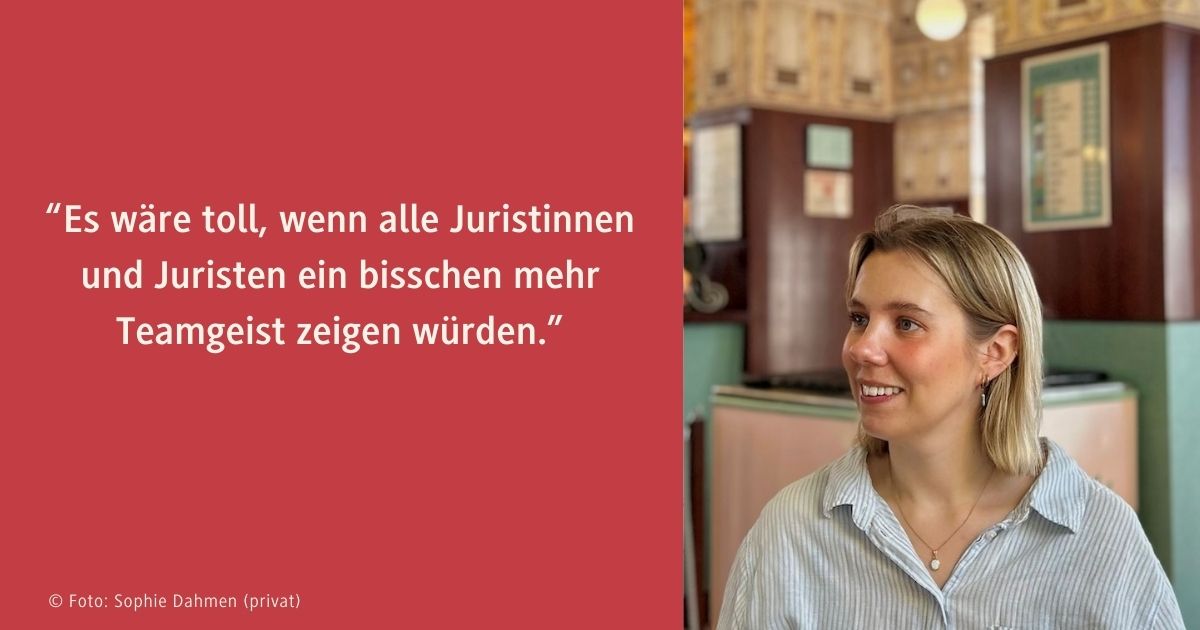beck-aktuell: Frau Dahmen, was war das Anliegen der iur.reform-Studie und wie wurde sie durchgeführt?
Dahmen: Kurz vor der Coronapandemie 2019 haben mehrere angehende Juristinnen und Juristen aus dem ganzen Bundesgebiet den Verein Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung e.V. gegründet, um eine Ausbildungs-Reform voranzutreiben. Dazu haben wir zunächst aufbereitet, welche Reformideen es in den letzten Jahrzehnten in der Literatur bereits gegeben hat. Aus diesen Vorschlägen haben wir einen Fragebogen mit 43 Thesen erstellt. Nach sechs Monaten haben rund 12.000 Personen den Fragenkatalog vollständig ausgefüllt – das war die größte Umfrage unter Juristinnen und Juristen, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Die Teilnehmenden konnten die 43 Thesen auf einer Skala von eins (volle Ablehnung) bis fünf (volle Zustimmung) bewerten. Dabei haben wir auch zwischen den verschiedenen Gruppierungen (Studierende, Referendare, Rechtsanwältinnen, Personen aus der Justiz, Professorinnen und Professoren sowie Mitarbeitenden der Justizprüfungsämter) unterschieden.
beck-aktuell: Und was waren Ihre Erkenntnisse?
Dahmen: Die erste Erkenntnis war, dass die juristische Ausbildung – so wie sie bisher in Deutschland besteht – nach der Meinung der Teilnehmenden grundsätzlich fortgeführt werden soll, also auch das erste und zweite Staatsexamen. Eine Mehrheit sprach sich für eine unabhängige Zweitkorrektur und die Einführung des E-Examens aus, außerdem stimmten viele gegen eine Ausweitung des Prüfungsstoffes, aber für die Zulassung anderer Prüfungsformen und die Verbesserung des Betreuungsschlüssels sowie das regelmäßige Monitoring des Jurastudiums. Vor allem Studierende wünschten sich außerdem den integrierten Bachelor und das Abschichten der ersten Staatsprüfung.
beck-aktuell: Die Studie erschien im Mai 2023: Wie waren die damaligen Rektionen?
Dahmen: Die Reaktionen waren überwiegend sehr positiv. Ich glaube, die Leute haben erkannt, dass wir mehr sind als nur ein studentischer Zusammenschluss, der irgendetwas fordert, was für die Studierenden günstig ist. Stattdessen kam es gut an, dass wir datenbasiert gearbeitet haben und unsere Thesen und deren Zustimmungswerte transparent veröffentlicht haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass unsere iur.reform-Studie dazu geführt hat, dass sich wieder viele Personen mit einer Reform der juristischen Ausbildung auseinandersetzen und darüber nachdenken.
Dass die Justizministerkonferenz (JuMiKo) im Juni 2024 verkündete, man sehe keinen grundlegenden Reformbedarf bei der juristischen Ausbildung, hat uns aber wirklich niedergeschmettert. Die Aussage geht zwar nur indirekt auf unsere iur.reform-Studie zurück und ist hauptsächlich im total veralteten Ergebnis des Koordinierungsausschusses der JuMiKo von 2019 begründet. Trotzdem ist es schade, dass die JuMiKo unsere Studie aus unserer Sicht falsch interpretiert oder nicht ausreichend berücksichtigt hat.
beck-aktuell: Gab es nach der Veröffentlichung Ihrer Studie auch Einladungen von Universitäten und aus der Politik?
Dahmen: Wir waren viel unterwegs und haben unsere Studie bundesweit präsentiert. Ich glaube, wir waren sogar in allen Landesjustizministerien eingeladen. Außerdem haben wir mit Politikerinnen und Politikern im Bundestag und den meisten Landtagen gesprochen. Und auch an den Unis gab es natürlich Veranstaltungen, auf denen wir unsere Ergebnisse präsentiert haben.
Zudem durften wir am Hamburger-Protokoll mitwirken, mit dem Vertreterinnen und Vertreter der Fakultäten ihre Forderungen für eine Reform der juristischen Ausbildung formuliert haben. Mit den Beteiligten stehen wir immer noch im Austausch.
"Es war tatsächlich sehr frustrierend zu sehen, wie die Politik hier auf die Bremse tritt."
beck-aktuell: Wie schätzen Sie den Umgang mit der Reform durch die Politik ein und wie wichtig sind politische Akteure?
Dahmen: Wir haben im Anschluss an die Veröffentlichung der Studie versucht, eine größere Reformdebatte anzustoßen. Bei der Akademie Loccum 2.0. sollten alle Stakeholder gemeinsam ergebnisoffen auf Grundlage der durch die iur.reform-Abstimmung ermittelten Daten beraten, wie die juristische Ausbildung zukunftsfest, gerechter und gesünder werden kann. Das war aber leider tatsächlich politisch einfach nicht gewollt. Hier sind wir als gemeinnütziger Verein, der politisch nicht legitimiert ist, einfach an unsere Grenzen gestoßen. Es war tatsächlich sehr frustrierend zu sehen, wie die Politik hier auf die Bremse tritt. Und allen voran die JuMiKo, die es eigentlich hätte besser wissen müssen. Die Landesgesetzgeber sind neben den juristischen Fakultäten natürlich sehr wichtig – sie können Reformentwicklungen gesetzlich vorantreiben oder eben auch stoppen.
beck-aktuell: Nun ist es nicht so, dass in der Zwischenzeit gar nichts passiert wäre. In Ihrer Studie hatte sich eine Mehrheit für den integrierten Bachelor ausgesprochen, der inzwischen fast überall eingeführt wurde. Wie bewerten Sie heute den Einfluss, den Sie auf die Reformdiskussion hatten?
Dahmen: In den letzten 150 Jahren gab es immer wieder wellenartig Auseinandersetzungen mit den Reformthemen. Deswegen ist es schwer zu sagen, worauf bestimmte Entwicklungen zurückzuführen sind. Wir freuen uns jedenfalls, dass der integrierte Bachelor inzwischen in fast allen Bundesländern eingeführt wurde oder es – wie zuletzt in Baden-Württemberg – zumindest Bestrebungen gibt, ihn einzuführen.
Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass unsere Studie dazu geführt hat, dass sich die Leute plötzlich wieder vermehrt mit den Reformthemen auseinandergesetzt haben – wir haben da bestimmt ein Umdenken angeregt. Vor allem das vermeintliche Argument "Wir haben das schon immer so gemacht" konnten wir entkräften.
beck-aktuell: Dennoch sind viele Vorschläge aus Ihrer Studie bis heute verhallt. War der Dialog mit der Politik für Sie am Ende eher frustrierend?
Dahmen: Besonders ärgerlich war für uns, dass uns viele eine gewisse Emotionalität beim Thema vorgeworfen haben, weil wir eben teilweise selbst noch im Studium oder im Referendariat waren. Das war sehr frustrierend, denn nach unserer Ansicht war genau das Gegenteil der Fall. Die Politik hat unsachgemäß argumentiert, beispielsweise bei der Behauptung, dass unsere Reformvorschläge zu einer Entwertung der juristischen Abschlüsse führen würden. Nur weil das Examen besonders schwer ist, macht es uns nach den heutigen Standards nicht zu besonders guten Juristinnen und Juristen. Denn es ist nicht einmal definiert, was eine gute Juristin ausmacht. "Wir haben das schon immer so gemacht" ist kein Argument. An dieser Stelle ist die Diskussion meiner Meinung nach leider komplett falsch abgebogen.
"Man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, es gibt immer eine Möglichkeit, etwas besser zu machen"
beck-aktuell: Wie soll es jetzt mit der Initiative weitergehen? Wollen Sie die Umfrage in ein paar Jahren nochmal durchführen?
Dahmen: Wir wissen noch nicht, wie es weiter geht. Das liegt unter anderem daran, dass viele Aktive im letzten Jahr ins Berufsleben eingestiegen sind und weniger Zeit haben. Wir wollen aber auf jeden Fall weiter machen – nur das Format ist noch nicht klar.
Wir wollen die Studie nicht einfach nochmal aufkochen, unsere Daten sind auch noch aktuell. Wir könnten uns aber vorstellen, auf unseren Ergebnissen aufzubauen oder auch mit einer anderen Initiative zu kooperieren. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, vor allem im Bereich des Referendariats. In fast jedem Bundesland gibt es einen Referendariatsrat, der sogar demokratisch legitimiert ist. Und auch die Bundesfachschaft hat eine Referendariatskommission gegründet – da gibt es noch viel zu tun.
beck-aktuell: Was können Jurastudenten und Referendarinnen tun, um sich aktiv in die Reformdebatte einzubringen?
Dahmen: Wir können allen Interessierten nur empfehlen, sich in einer der Gruppierungen einzubringen. Das geht niedrigschwellig und macht auch großen Spaß. An den Unis gibt es verschiedene Interessenvertretungen – allen voran die Fachschaften, aber natürlich auch andere Gruppen wie zum Beispiel die Arbeitskreise der kritischen Jurist*innen oder auch feministische Zusammenschlüsse. Natürlich kann man auch eine eigene Gruppe gründen und diskutieren. Unser Projekt ist auch daraus entstanden, dass wir vor unserer eigenen Haustür gekehrt haben. Große, bundesweite Projekte gibt es natürlich auch, aber da ist, glaube ich, die Hemmschwelle ein bisschen höher, sich zu beteiligen.
Man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken, es gibt immer eine Möglichkeit, etwas besser zu machen. Lasst Euch nicht von Neinsagern in Elfenbeintürmen davon abhalten! Es wäre toll, wenn alle Juristinnen und Juristen ein bisschen mehr Teamgeist zeigen würden.
beck-aktuell: Vielen Dank für das Gespräch.
Sophie Dahmen ist Vorständin von Bündnis zur Reform der juristischen Ausbildung e.V. Sie arbeitet als angestellte Rechtsanwältin in Hamburg.
Das Interview führte Dr. Jannina Schäffer.