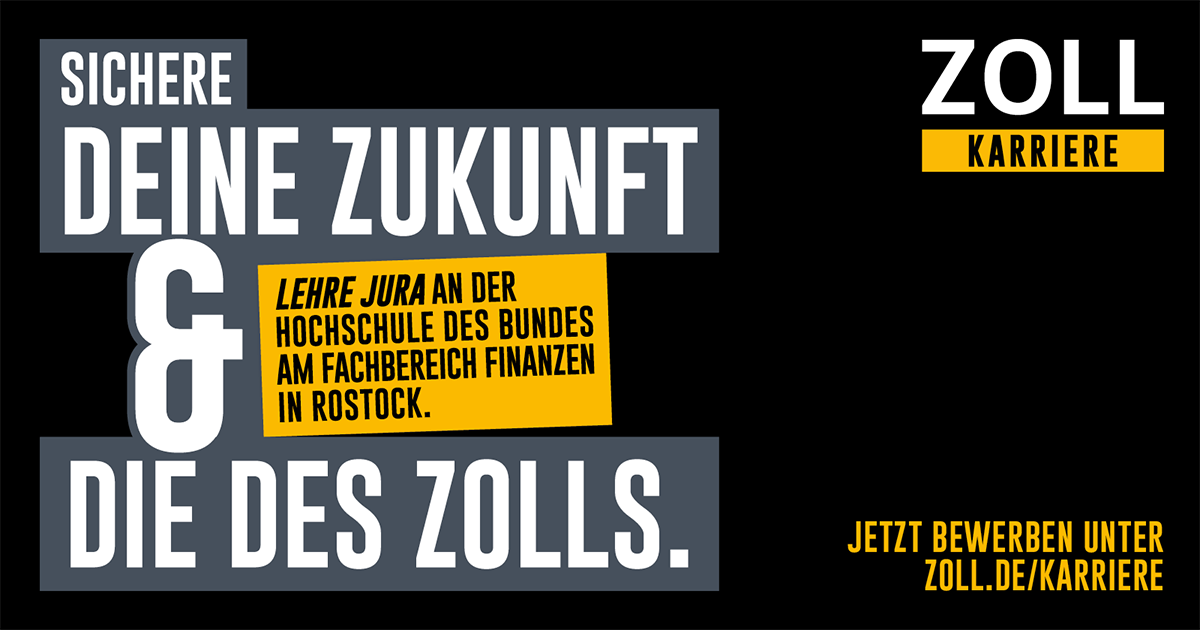beck-aktuell: NGOs sind wesentlicher Teil unseres Gemeinwesens, stehen aber inzwischen stark unter Druck: Attac, eine Organisation, die sich für die Besteuerung von Finanztransaktionen einsetzt, und anderen wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt und die Union stellte ihre berüchtigten 551 Fragen zu staatlich geförderten Organisationen im Bundestag. Herr Professor Küstermann, wie verunsichert erleben Sie die Szene aktuell?
Küstermann: Ich erlebe sie als sehr verunsichert. Es gab zuletzt eine Veranstaltung der Deutschen Stiftung Engagement und Ehrenamt zur Frage der Zulässigkeit politischer Betätigung durch gemeinnützige Organisationen. Die war so gut besucht, wie ich es noch nicht im gemeinnützigen Sektor erlebt habe.
beck-aktuell: Woher rührt die Verunsicherung maßgeblich?
Küstermann: Das liegt sicherlich auch an den 551 Fragen, die Sie angesprochen haben. Es liegt aber auch daran, dass gemeinnützige Organisationen insgesamt zunehmend unter Druck geraten und dass sie mitunter beim Finanzamt angeschwärzt werden mit der Aussage: "Schaut doch mal genau hin, ob diese Organisation mit ihrer politischen Betätigung wirklich noch gemeinnützig ist".
beck-aktuell: Wo verlaufen denn die Grenzen der Gemeinnützigkeit und warum ist sie so relevant?
Küstermann: Da muss ich etwas ausholen: Wir haben einerseits die gemeinnützigen Organisationen und andererseits die politischen Parteien. Und dazwischen zieht das Recht mit gutem Grund eine Grenze. Denn über politische Parteien versuchen wir als Bürgerinnen und Bürger, in Wahlen und Abstimmungen Einfluss auf die politische Willensbildung zu nehmen. Deshalb haben wir ein besonderes Interesse daran, zu wissen, wer sie finanziert und woher diese Mittel kommen. Aus diesem Grund unterliegen politische Parteien ganz anderen Transparenzpflichten als gemeinnützige Organisationen und die Abzugsmöglichkeit von Zuwendungen an politische Parteien ist wesentlich eingeschränkt gegenüber derjenigen an gemeinnützige Organisationen.
"NGOs dürfen in Einzelfällen auch zu Demonstrationen gegen Rassismus aufrufen"
beck-aktuell: Das Verfahren zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist ja im Jahr 2013 in § 60a AO formalisiert worden. Welche Bedeutung hatte die Änderung?
Küstermann: Da müssen wir verschiedene Situationen unterscheiden. In dem Zeitpunkt, in dem eine Organisation gegründet wird, haben wir nur ihre Satzung, um zu überprüfen, ob die Vorgaben des Gemeinnützigkeitsrechts eingehalten werden. Papier ist aber bekanntlich geduldig. Daher braucht es für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit eigentlich auch noch der Überprüfung der tatsächlichen Geschäftsführung. Und § 60a AO, die sogenannte gesonderte Feststellung, greift zu dem Zeitpunkt, in dem die Organisation errichtet worden oder ihre Satzung geändert worden ist und sie noch nicht unter Beweis stellen konnte, dass sie die Regelungen der Satzung auch in der tatsächlichen Arbeit mit Leben füllt. Die Feststellung nach § 60a AO ist rechtlich bindend. Sie hat damit eine stärkere Wirksamkeit, als das vorher der Fall war.
Insofern ist die Position der gemeinnützigen Organisationen also gestärkt worden. Bei der politischen Betätigung geht es aber vielfach um die Frage der tatsächlichen Geschäftsführung, also ob die Satzung in der Praxis mit Leben gefüllt wird. Und da prüft dann das Finanzamt erneut.
beck-aktuell: Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass eine Organisation trotz einer gewissen politischen Tätigkeit noch gemeinnützig ist?
Küstermann: Es gibt hier drei Punkte, die ich unterscheiden würde: Punkt eins ist die Feststellung, dass eine gemeinnützige Organisation keine politische Partei ist. Als Punkt zwei muss man sagen, dass gemeinnützige Organisationen wichtige Zwecke in der Bildung, im Sport, in der Völkerverständigung oder auf anderen Gebieten erfüllen. Sie wissen, wo auf ihrem Gebiet Not am Mann ist. Und wer, wenn nicht diese Organisationen, sollten das Wissen haben, um es auch in den politischen Willensbildungsprozess einzubringen und Verbesserungen zu erwirken? Das ist auch in Ordnung und mit dem Gemeinnützigkeitsrecht zu vereinbaren, sofern es parteipolitisch neutral erfolgt und der Erfüllung der eigenen Zwecke dient. Der dritte Punkt ist, dass es vor dem Hintergrund des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit unproblematisch ist, wenn eine Organisation in vereinzelten Fällen außerhalb ihres Zwecks zu Demonstrationen zum Beispiel gegen Rassismus und für Völkerverständigung aufruft.
"Schaut in Eure Satzung und für welchen Zweck Ihr unterwegs seid"
beck-aktuell: Beim Begriff "vereinzelt" könnte das Problem liegen, denn mit einer erstarkten AfD und einer mutmaßlich nach rechts gerückten Union wird es vermutlich immer mehr Menschen "gegen rechts" auf die Straße treiben. Was ist nun, wenn eine NGO bspw. alle drei Monate zu einer solchen Demonstration aufruft?
Küstermann: Dazu gibt es noch keine Rechtsprechung, das wird sich zeigen. Ich würde den NGOs aber sagen: Schaut in Eure Satzung und für welchen Zweck Ihr unterwegs seid. Anhand dessen würde ich mir überlegen, was eine Organisation an politischen Forderungen braucht, um ihren Zweck auch mit Leben füllen zu können.
beck-aktuell: Wie eng muss man diesen Zweck denn auslegen?
Küstermann: Stellen Sie sich vor, eine Sportorganisation ruft zu einer Demonstration "gegen rechts" und für Völkerverständigung auf. Sport bedeutet für mich auch Fairness, Miteinander und Gleichberechtigung, damit der Wettbewerb funktionieren kann. Wenn ich über diesen Weg gehe, dann hätte ich einen gewissen Hebel, um erklären zu können, warum bestimmte politische Aktivitäten auch für den Sport wichtig sind und warum ich für dieses Thema auch auf die Straße gehen darf.
beck-aktuell: Kommen wir zur Rolle des Bundesfinanzministeriums, dieses nimmt bei der Auslegung und Anwendung der Abgabenordnung ja eine wichtige Rolle ein. Wie relevant ist es für die NGOs, aus welcher Partei der Finanzminister kommt?
Küstermann: Wir haben neben der Abgabenordnung noch den Anwendungserlass zur Abgabenordnung, in dem das Bundesfinanzministerium konkretisiert, wie einzelne Bestimmungen des Gemeinnützigkeitsrechts zu verstehen sind. Darin zeichnet es im Wesentlichen nach, was der BFH 2019 etwa in seiner Attac-Entscheidung zur Unterscheidung von gemeinnützigem Engagement und politischer Betätigung gesagt hat. Auch wenn wir eine andere Farbe im Bundesfinanzministerium haben, bleibt die Rechtsprechung des BFH aber erst einmal bestehen und ein etwaiger neuer Erlass müsste der Prüfung durch die Gerichte standhalten.
Gleichwohl ist diese Lage auch der Grund, warum sich einige Bündnisse dafür stark machen, dass es eine Regelung zur Zulässigkeit politischer Betätigung nicht auf der Ebene eines Anwendungserlasses, sondern direkt in der Abgabenordnung – also in Gesetzesform – geben sollte.
"Die Grenze zwischen Parteipolitik und Gemeinnützigkeit muss neu austariert werden"
beck-aktuell: Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD finden sich auch Regelungen zur Gemeinnützigkeit. Wie bewerten Sie diese?
Küstermann: Zur politischen Betätigung äußert sich der Koalitionsvertrag nicht. Aber wenn man sich anschaut, was dort steht, ist das auch eine Stärkung der gemeinnützigen Organisationen. Da geht es u.a. um den Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung, aber auch um eine – gerade für kleinere Organisationen – relativ komplizierte Sphärenaufteilung. In der Tätigkeit gemeinnütziger Organisationen unterscheiden wir nämlich die ideelle Sphäre, die Vermögensverwaltung, den Zweckbetrieb und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und jede Sphäre ist mit unterschiedlichen Steuern verbunden, wie Ertragsteuer und Umsatzsteuer. Hier soll eine Erleichterung erfolgen, dass bis zu 50.000 Euro an Einnahmen eine Unterscheidung zwischen Zweckbetrieb und wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb nicht mehr erforderlich ist. Das würde sicherlich eine Erleichterung für die Organisationen bedeuten.
beck-aktuell: Wenn wir am Ende zu einer Bewertung kommen: Attac wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil sie offensichtlich zu weit gegangen sind, anderen ging es genauso. Muss man nicht auch den NGOs den Vorwurf machen, dass sie es mit ihrem Engagement ein bisschen übertrieben haben oder sehen Sie die Verantwortung eher bei den Konservativen, die versuchen, hier ein wenig amerikanischen Kulturkampf in die Zivilgesellschaft zu tragen?
Küstermann: Wenn man sich die kleine Anfrage der CDU/CSU Fraktion im Bundestag anschaut, die im Detail sehr verwunderlich war, fragt man sich schon, ob sie das bewusst so gemacht hat, um einfach mal mit dem Hammer draufzuhauen oder ob das einfach Unwissenheit ist. Aber das kann ich am Ende nicht beurteilen. Ich denke aber auch, dass die Grenze zwischen parteipolitischer und gemeinnütziger Betätigung eben nicht klar zu ziehen ist und immer wieder neu austariert werden muss. So gab es neben Attac und Co. durchaus auch Fälle, in denen der BFH eine politische Betätigung als gemeinnützig anerkannt hat. Wir müssen eben in jedem Fall neu entscheiden, wo die Grenze verläuft.
beck-aktuell: Herr Professor Küstermann, ich danke Ihnen für das Gespräch!
Prof. Dr. Burkhard Küstermann lehrt Rechtswissenschaft, insbesondere das Recht der Existenzsicherung und Sozialverwaltungsrecht, an der Hochschule Bielefeld. Er referiert zudem zum Gemeinnützigkeitsrecht und berät auch gemeinnützige Organisationen.
Das Interview entstand im Rahmen eines Gesprächs in Folge 53 von Gerechtigkeit & Loseblatt, dem Podcast von NJW und beck-aktuell. Die Fragen stellte Dr. Hendrik Wieduwilt.