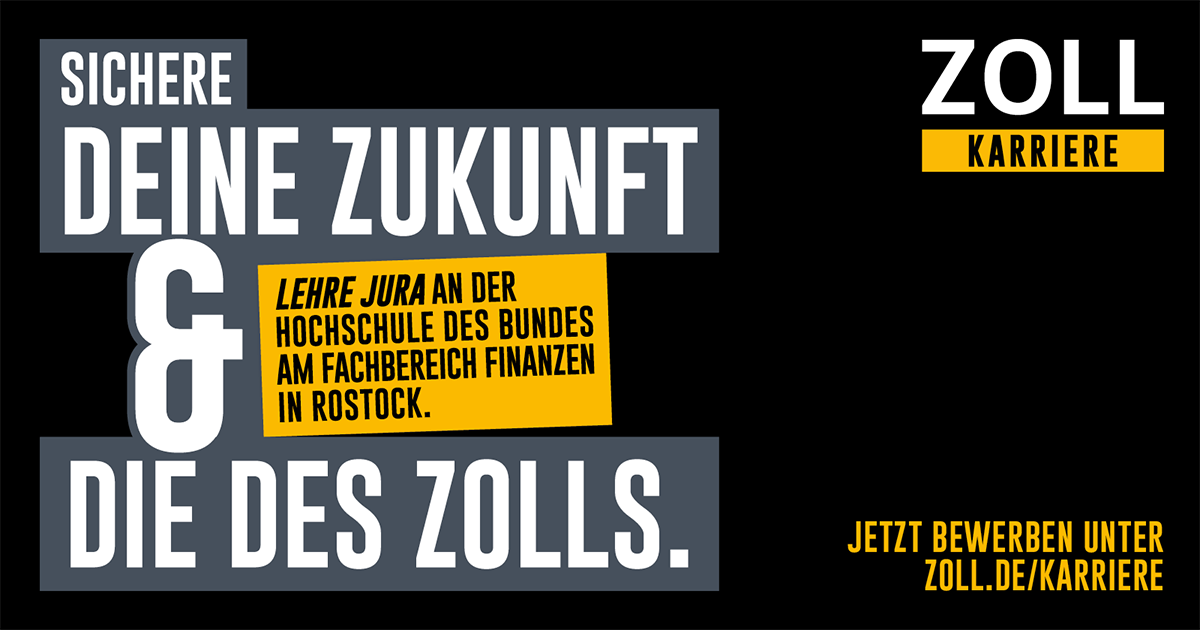beck-aktuell: Am 2. Mai kam es zu einem politischen Beben. "Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Alternative für Deutschland seit dem heutigen Tag aufgrund der die Menschenwürde missachtenden extremistischen Prägung der Gesamtpartei als gesicherte rechtsextremistische Bestrebung ein." Das ist die Mitteilung der Behörde. Sie ist anderthalb Seiten lang und gibt das Ergebnis eines ungefähr tausendseitigen Gutachtens wieder. Seitdem debattiert das Land. Professor Lindner, was bedeutet die Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung?
Lindner: Es ist die Feststellung, dass die AfD nach Ansicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz gesichert auf eine Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gerichtet ist. Sie ist also nicht mehr nur ein Verdachtsfall, wie es bisher war, sondern eine Stufe höher einzuordnen, was dann letztlich auch einige rechtliche Konsequenzen hat. Sie kann in Zukunft zum Beispiel leichter überwacht werden.
beck-aktuell: Sie haben selbst über Verfassungstreue publiziert. Nun es gibt schon einige Juristinnen und Juristen, die sagen, jetzt wird sogar das Liken von AfD-Beiträgen gefährlich. Was droht AfD-Mitgliedern oder sogar Beamten, die sich mit AfD-Inhalten identifizieren?
Lindner: Hier muss man unterscheiden. Die Mitgliedschaft eines Beamten in einer vom BVerfG nicht für verfassungswidrig erklärten Partei ist als solches noch kein Dienstvergehen und kann nicht zur Entlassung aus dem Dienst oder zu sonstigen disziplinarrechtlichen Maßnahmen führen. Hier greift das Parteienprivileg ein, das besagt, dass solche harten Rechtsfolgen dann eintreten können, wenn das BVerfG die Partei verboten hat.
Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob das AfD-Mitglied oder der Beamte sich im Einzelfall verfassungstreu verhält. Die Höherstufung kann durchaus ein Anlass sein, bei Beamtinnen und Beamten, wo man Anhaltspunkte dafür hat, dass die Verfassungstreue nicht gegeben ist, dem im Einzelfall nachzugehen. Das kann dann natürlich zu dienstrechtlichen Konsequenzen führen. Es besteht aber kein Automatismus zwischen der Mitgliedschaft und einem Disziplinarverfahren.
"Das bloße Zusammentragen von Geschmacklosigkeiten reicht nicht"
beck-aktuell: Zur Begründung der Einstufung heißt es, dass das in der Partei vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar sei. Die AfD betrachte zum Beispiel deutsche Staatsangehörige mit Migrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern nicht als gleichwertige Angehörige des durch die Partei ethnisch definierten deutschen Volkes. Halten Sie das für eine tragfähige Begründung?
Lindner: Tatsächlich kenne ich bisher auch nur die Pressemitteilung, aber die Begründung kann schon tragfähig sein. Wenn der Verfassungsschutz tatsächlich Erkenntnisse hat, dass die AfD zielgerichtet den Wert der Menschenwürde angreift, insbesondere die Gleichwertigkeit aller Menschen in Frage stellt, dann wäre das aus meiner Sicht schon ein gewichtiges Argument dafür, dass diese Einstufung begründet ist.
Das Zusammentragen bloßer Geschmacklosigkeiten und Ansichten, die man so nicht formulieren sollte, reicht dagegen nicht aus. Auch überspitzte polemische Äußerungen gegen die Migrationspolitik würden noch nicht ausreichen, weil das noch vom weiten Schutzbereich der Meinungsfreiheit gedeckt ist, wie ihn das BVerfG vertritt. Es muss die Absicht der Partei hinzukommen, rechtlich relevante oder zumindest gesellschaftlich relevante Abstufungen zwischen verschiedenen Personengruppen zu machen. Das wäre dann in der Tat ein Problem von Art. 1 GG. Aber dazu müsste man sich tatsächlich dieses Gutachten ansehen.
"Eine Veröffentlichung ist zwingend notwendig"
beck-aktuell: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat das AfD-Gutachten bisher nicht veröffentlicht – mit Verweis auf Quellenschutz. Was halten Sie von diesem Vorgehen?
Lindner: Auch hier ist eine Unterscheidung notwendig. Zunächst einmal die Frage, ob überhaupt eine Veröffentlichung notwendig ist. Das ist aus meiner Sicht zwingend der Fall. Wir haben hier einen Eingriff des Bundesamtes – also des Staates – in den Parteienwettbewerb. Wir haben einen Eingriff in die öffentliche Meinungsbildung. Allein die Pressemitteilung kann für die betroffene Partei zu erheblichen Nachteilen führen. Ich denke, hier besteht ein rechtsstaatlich begründetes Interesse – aus meiner Sicht sogar aus dem Demokratieprinzip ableitbar –, dass die Öffentlichkeit Näheres zu den Gründen erfährt.
Davon zu unterscheiden ist die Frage der Modalität der Veröffentlichung. Natürlich ist es einem Geheimdienst nicht angemessen, das Gutachten eins zu eins ins Internet zu stellen, sodass jede Quelle, jede Methode, jedes Datum nachvollzogen werden kann. Aber ich denke schon, dass die wesentlichen Belege anonymisiert oder mit kenntlich gemachten Auslassungen schon öffentlich sein sollten. Aus der Pressemitteilung allein kann niemand konkret nachvollziehen, ob die Hochstufung begründet ist. Das halte ich in einem Rechtsstaat für ein Problem.
beck-aktuell: Die AfD hat Klage und Eilantrag schon beim VG Köln eingereicht. Der Verfassungsschutz hat inzwischen eine Stillhaltezusage gemacht. Kommt im Zuge des Verfahrens das Gutachten nicht ohnehin auf den Tisch?
Lindner: Ich gehe davon aus, dass der AfD das Gutachten vorliegt, sonst hätte man wahrscheinlich diese Klage gar nicht schreiben können. Im Prozess selbst muss das natürlich als Beweismittel oder Prozessgegenstand eingeführt werden. Aber auch hier sieht die Verwaltungsgerichtsordnung bestimmte Geheimhaltungsmechanismen vor. Das Bundesinnenministerium könnte die Vorlage vor Gericht gemäß § 99 VwGO untersagen. Dann muss gerichtlich entschieden werden, ob das Gutachten geheimhaltungsbedürftig ist. Es ist auch denkbar, dass die Behörde verpflichtet wird, das Gutachten unter Geheimhaltungssicherungsmaßnahmen dem Gericht zur Kenntnis zu geben.
"Ein Verbotsverfahren könnte Jahre dauern"
beck-aktuell: Das heißt, das Innenministerium spielt da letztlich die entscheidende Rolle. Wie unabhängig ist denn das Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich?
Lindner: Rechtlich ist es ganz klar: das Bundesamt für Verfassungsschutz ist eine dem Innenministerium nachgeordnete Behörde. Das heißt im Klartext nichts anderes, als dass das Ministerium eine volle inhaltliche Weisungsbefugnis gegenüber dem Amt hat. Der Gesetzgeber hat hier gar keine Unabhängigkeit gewollt. Auch wenn das Innenministerium die Veröffentlichung des Gutachtens anordnet, wäre das in einem Rechtsstaat ein ganz normaler Vorgang.
beck-aktuell: Aktuell gibt es auch viele Debatten um ein mögliches Verbotsverfahren. Union und SPD haben sich nach der Hochstufung allerdings zunächst verhalten geäußert. Wie beurteilen Sie das: Wiegen die Argumente für ein Verbot jetzt schwerer?
Lindner: Ich könnte jetzt nicht reinen Gewissens behaupten, dass die Hochstufung gar keine Auswirkung auf diese Frage hat, da ich das Gutachten nicht kenne. Allerdings ist sie auch nicht zwingend ein Argument für ein Verbotsverfahren. Das BVerfG wäre an dieses Gutachten auch nicht gebunden. Es müsste sich selbst ein Bild machen. Das kann auch dauern: in unter drei Jahren halte ich das für kaum machbar.
Und bezüglich der zeitlichen Komponente darf man eine Sache auch nicht außer Acht lassen: Selbst wenn das BVerfG dieses Verbot ausspräche, könnte dagegen der EGMR angerufen werden, der sich bereits mit Parteiverboten befasst hat. Es besteht also die Gefahr, dass sich das Verfahren über Jahre hinziehen würde, bevor wir eine Entscheidung hätten, aus der wir auch Konsequenzen ziehen können. Und für mich stellt sich dann die Frage: wie geht man bis dahin in der politischen Diskussion mit der AfD um?
"Auch ein Verfahren hat politische Wirkung"
beck-aktuell: Unter Juristinnen und Juristen gibt es aber auch diejenigen, die ein jahrelanges Verfahren befürworten. Ihr Argument: Die Partei werde sich schon deshalb entradikalisieren, um dem Diktum – also dem Verbot – zu entgehen. Was halten Sie davon?
Lindner: Das ist reine Spekulation. Natürlich hat ein solches Verfahren politische Wirkung, etwa auf die Spendenbereitschaft der Menschen oder die Mitgliederzahl. Aber zu sagen, die Partei entradikalisiert sich selbst, kann auch ein gewaltiger Fehlschluss sein. Die Taktik der AfD könnte zum Beispiel auch darin bestehen, sich zwar zunächst zurückzuhalten, aber dann – sobald das Verbotsverfahren gescheitert ist – wieder zur üblichen Radikalität überzugehen. Und damit wäre für niemanden etwas gewonnen.
beck-aktuell: Herr Professor Lindner, vielen Dank für das Gespräch!
Prof. Dr. Josef Franz Lindner ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Augsburg.
Der Text basiert auf dem Gespräch in Folge 52 von Gerechtigkeit & Loseblatt, dem Podcast von beck-aktuell und NJW. Die Fragen stellte Hendrik Wieduwilt.
.png?sfvrsn=621cd2a0_1)