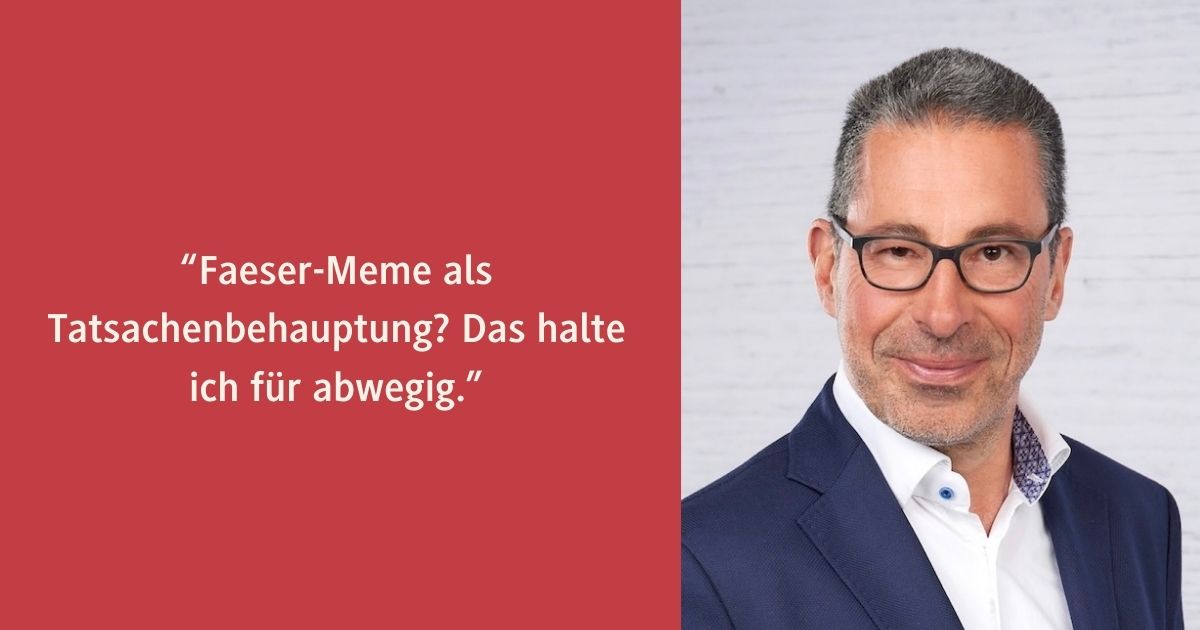beck-aktuell: Herr Engländer, in der vergangenen Woche sorgte ein Urteil des AG Bamberg gegen den Chefredakteur des Deutschlandkuriers, David Bendels, für Aufregung. Er hatte auf X ein Meme gepostet, das Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einem Schild zeigte, auf dem stand: "Ich hasse die Meinungsfreiheit". Dabei handelte es sich wohl um eine von Bendels angefertigte Montage, die ihm eine Verurteilung zu sieben Monaten auf Bewährung einbrachte. Grundlage war § 188 StGB, die sogenannte "Politikerbeleidigung". Woher kommt diese Strafnorm eigentlich?
Engländer: Dieser Tatbestand ist schon relativ alt, er wurde 1951 in das StGB aufgenommen. Hintergrund war damals schon, dass man der Verrohung des politischen Diskurses entgegenwirken wollte. Man wollte verhindern, dass die politische Atmosphäre vergiftet wird.
beck-aktuell: Ein ähnliches Motiv hat den Bundesgesetzgeber auch 2021 angetrieben, als er mit dem "Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität" u. a. § 188 StGB nachgeschärft hat. Was hat sich dadurch geändert?
Engländer: Es sind zunächst einmal zwei Punkte geändert worden. Früher war es so, dass dieser Tatbestand Politikerinnen und Politiker auf der Kommunal- und Bezirksebene nicht erfasst hat. Der Gesetzgeber war jedoch nun der Auffassung, dass diese Personen ganz besonders schutzwürdig seien und hat insoweit eine Erweiterung vorgenommen.
Die zweite Änderung betrifft die Anknüpfungspunkte des § 188 StGB, der ja ein Qualifikationstatbestand ist und daher voraussetzt, dass zunächst ein anderes Äußerungsdelikt erfüllt ist. Früher waren das nur die üble Nachrede und die Verleumdung. Mit der Reform kam dann auch noch die Beleidigung als Grunddelikt hinzu.
"Ich halte das für abwegig"
beck-aktuell: Hatte diese Reform irgendeine Auswirkung auf den Fall Bendels?
Engländer: Nein, weil es sich bei Frau Faeser um eine Bundespolitikerin handelt und das Amtsgericht festgestellt hat, dass hier eine Verleumdung vorliege. Nach dieser Wertung wäre dieses Verhalten auch schon nach der alten Fassung der Norm strafbar gewesen.
Der entscheidende Streit spielt sich daher bei der Verleumdung nach § 187 StGB ab und konkret bei der Frage, ob dieser Straftatbestand überhaupt erfüllt ist, wie das Amtsgericht annimmt, oder ob es nicht gute Gründe dafür gibt, das anders zu sehen.
beck-aktuell: Das ist auch der Haupt-Kritikpunkt am Urteil des AG Bamberg. Wenn man sich im Internet umschaut, findet man unzählige bearbeitete Fotos. Und die Vorstellung, dass Frau Faeser sich tatsächlich mit einer solchen Aussage ablichten ließe, scheint doch einigermaßen absurd. Insofern drängt sich die Frage auf, ob dieses Meme nicht offenkundig satirisch gemeint ist, wie Bendels selbst behauptet. Wie sehen Sie das?
Engländer: Ja, ich halte die Vorstellung, jemand könne das ernst nehmen, auch für abwegig. Aus dem verobjektivierten Empfängerhorizont scheint klar zu sein: Niemand würde auf die Idee kommen, dass Frau Faeser tatsächlich eine solche Äußerung getätigt hat. Wenn man mit Memes ein wenig vertraut ist, bemerkt man sofort, dass es hier darum geht, eine bestimmte politische Haltung zu kritisieren, die Herr Bendels Frau Faeser unterstellt.
"Es geht um die Funktionsfähigkeit unseres politischen Betriebes"
beck-aktuell: Gleichwohl hat der Fall noch eine andere Seite: Die Reform 2021 geschah auch im Lichte des Todes des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der von einem Rechtsextremisten ermordet worden war. Man wollte damals den verbalen Nährboden für solche Gewalttaten austrocknen, wofür auch ein gewisser öffentlicher Rückhalt bestand. Nun, einige Jahre danach, scheint das Pendel der öffentlichen Meinung in eine andere Richtung zu schwingen. Ist es aus Ihrer Sicht der richtige Ansatz, Politikerinnen und Politikern im Äußerungsstrafrecht einen höheren Schutz zuzubilligen?
Engländer: Dazu ist es wichtig, sich mit dem Schutzzweck von § 188 StGB zu befassen. Geht es dabei tatsächlich um die Ehre des Politikers, bzw. der Politikerin, die mehr wert sei als die anderer Bürgerinnen und Bürger, wie von manchen unterstellt wird? Oder geht es nicht viel mehr um etwas anderes, nämlich dass wir als Allgemeinheit ein Interesse daran haben, dass unsere politischen Debatten auf eine vernünftige Art und Weise stattfinden und die von uns gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten ihre Aufgabe auch erfüllen können, ohne Angst vor Repressalien zu haben?
Mir scheint genau dieser Punkt hinter der erhöhten Strafandrohung in § 188 StGB zu stecken: Es geht nicht um eine Höhergewichtung der Ehre des Politikers oder der Politikerin, sondern um ein Allgemeininteresse an der Funktionsfähigkeit unseres politischen Betriebs.
"Das ist keine gängige Bewährungsauflage"
beck-aktuell: Es geht also um ein überindividuelles Rechtsgut?
Engländer: Meiner Ansicht nach ja. Das ist aber umstritten. Es gibt auch Auffassungen im Schrifttum und in der Rechtsprechung, die das Schutzgut rein individualistisch sehen wollen. Das scheint mir aber schwer zu begründen. Zudem muss man sehen, dass dieser Straftatbestand bereits vom BVerfG überprüft wurde, auch wenn das schon lange zurückliegt, im Jahr 1955. Damals hat das BVerfG die Norm für verfassungskonform befunden und sich in seiner Begründung auf das von mir genannte Allgemeininteresse bezogen.
beck-aktuell: Ein weiterer Aspekt im Fall von Herrn Bendels ist eine Bewährungsauflage, die das AG Bamberg angeordnet hat. Danach muss er sich bei Frau Faeser für seine Tat entschuldigen. Die Konsequenz ist: Tut er dies nicht, geht er ins Gefängnis. Ist Ihnen so eine Auflage schon einmal untergekommen?
Engländer: Das ist sicherlich keine gängige Bewährungsauflage. Allerdings hat es ähnliche Auflagen im Zusammenhang mit Beleidigungsdelikten schon gegeben. § 56b StGB sagt, dass das Gericht dem Verurteilten auferlegen kann, den durch die Tat verursachten Schaden nach Kräften wieder gut zu machen. Darauf gestützt hat es tatsächlich schon Auflagen gegeben, dass der Beleidiger in der Öffentlichkeit eine Ehrerklärung zugunsten des oder der Beleidigten abzugeben habe.
Es ist jedoch in der Tat eine eher seltene Auflage und man kann sich schon fragen, ob eine Entschuldigung – anders als eine öffentliche Ehrerklärung – tatsächlich geeignet wäre, den verursachten Schaden hier wieder gut zu machen – wenn man einen solchen hier einmal probehalber unterstellt. Um zu sehen, was sich das Amtsgericht dabei gedacht hat, wird man die Urteilsgründe abwarten müssen.
beck-aktuell: Herr Engländer, ich danke Ihnen für das Gespräch!
Prof. Dr. Armin Engländer ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die Fragen stellte Maximilian Amos.
Das ganze Gespräch hören Sie in der aktuellen Folge 50 von Gerechtigkeit & Loseblatt, dem Podcast von NJW und beck-aktuell.