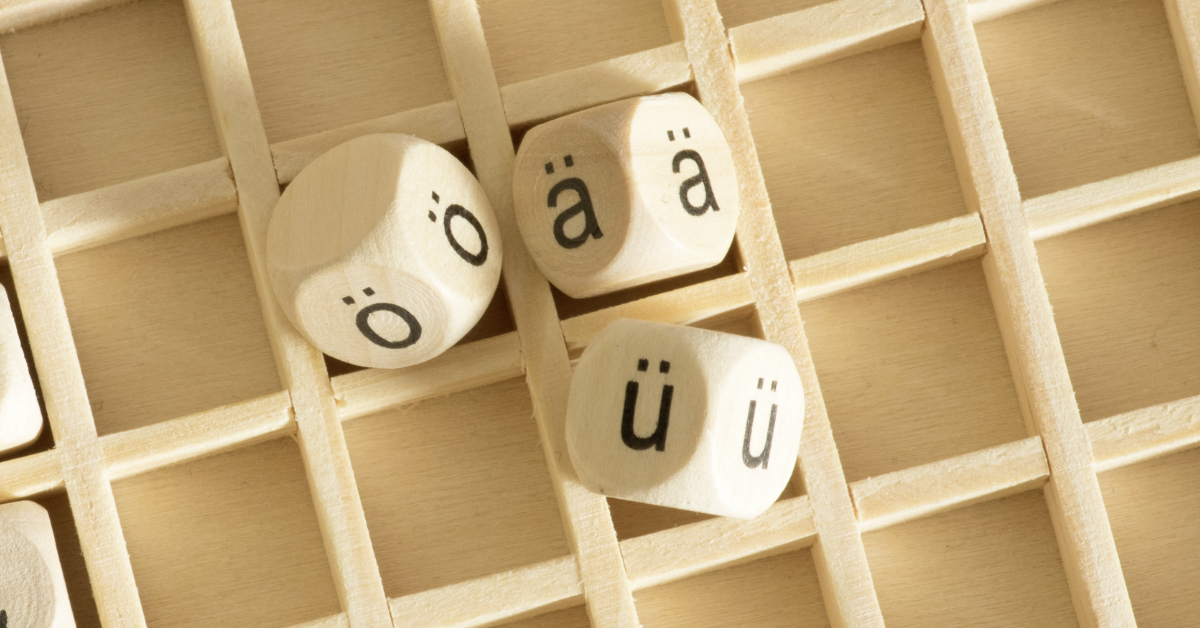Lost in Translation
Ein Patent zur Messung menschlicher Aktivität war vom Bundespatentgericht für nichtig erklärt worden. Bei Einreichung der Berufungsbegründung bedienten sich die Anwälte des Patentinhabers des beA. Augenscheinlich verlief die Übermittlung ohne Probleme. Das System bestätigte den Eingang. Tatsächlich wurde das Dokument auf dem "Empfänger-Intermediär der IT Baden-Württemberg im EGVP-Netzwerk", dem Empfangssystem des BGH, gespeichert. Dort endete die Reise mit einer Fehlermeldung - eine Übermittlung an das Postfach scheiterte. Grund war wahrscheinlich die Verwendung eines Umlaut oder anderen Sonderzeichens.
Zulässig, aber nicht erfolgreich
In der Sache blieb das Patent nichtig, aber immerhin sahen die Karlsruher Richter die Frist als erfolgreich gewahrt an. Die nach § 130a Abs. 5 Satz 1 ZPO "zum Empfang bestimmte Einrichtung" des Gerichts sei nach Auskünften der BRAK und der Verwaltung des BGH das vorgeschaltete Empfangssystem des BGH, nicht aber das konkrete Postfach. Die Absender hätten zwar wohl durch Verwendung von Umlaut oder Sonderzeichen das System überfordert, aber dies stelle keine Verwendung einer ungeeigneten Datei dar. Den Anwenderregeln konnte der Senat kein Verbot von Umlauten entnehmen. Insofern handele es sich um ein gerichtsinternes Problem - damit müsse der Verwender nicht rechnen, wenn ihm das beA vorher die erfolgreiche Versendung bestätigt habe.
Abgrenzung zu einer BFH-Entscheidung
Eine mehr technische als rechtliche Abgrenzung nahm der BGH zu der Entscheidung des BFH (NJW 2019, 2647) vom letzten Jahr vor. Der BFH hatte in einem vergleichbaren Fall Wiedereinsetzung gewährt und war somit von einer versäumten Frist ausgegangen. Beim obersten Finanzgericht sei ein weiterer zwischengeschalteter Server vorhanden, auf welchen die Nachricht unerreichbar vorschoben worden sei, so dass die technischen Gegebenheiten des Empfangssystems nicht vergleichbar seien. Der Senat sah somit keine Notwendigkeit, eine Klärung durch den Gemeinsamen Senat der Bundesgerichte herbeizuführen. Die technische Prämisse des BFH, dass hier kein wirksamer Eingang erfolgt sei, wurde von Experten kritisch hinterfragt (Müller, NZA 2019, 1120). Nach seiner Ansicht war auch dort schon mit Eingang auf dem "Empfänger-Intermediär" der Zugang erfolgt. Gleichwohl legte er den Anwendern die Empfehlung der BRAK ans Herz, auf Umlaute zu verzichten, die infolge der Rechtsprechung des BFH erfolgt war.
Anwälte wünschen sich gesetzliche Detailregelung
Eine gesetzliche Regelung der Dateibezeichnungen wünscht sich Rechtsanwalt Martin Schafhausen, der im Deutschen Anwaltverein als Präsidiumsmitglied und Ausschussvorsitzender für den elektronischen Rechtsverkehr zuständig ist. Im NJW-Editorial zu Ausgabe 30 mahnt er an, dass verständliche Dokumentennamen nicht einseitig von der Anwaltschaft gefordert werden dürften. Insgesamt müssten die Risiken der Nutzung des beA angemessen zwischen Gerichten und Nutzern aufgeteilt werden. Die vorangegangene Entscheidung des X. Zivilsenats - keine Nutzungspflicht des beA wegen Störanfälligkeit -, sieht er kritisch und konstatiert, dass der BGH keine grundlegende Antwort zur Nutzungspflicht gegeben habe. Vielmehr seien mit der Figur der "Störanfälligkeit" neue Fragen entstanden, so zum Beispiel mit Blick auf technisch anfällige Telefaxe over IP.