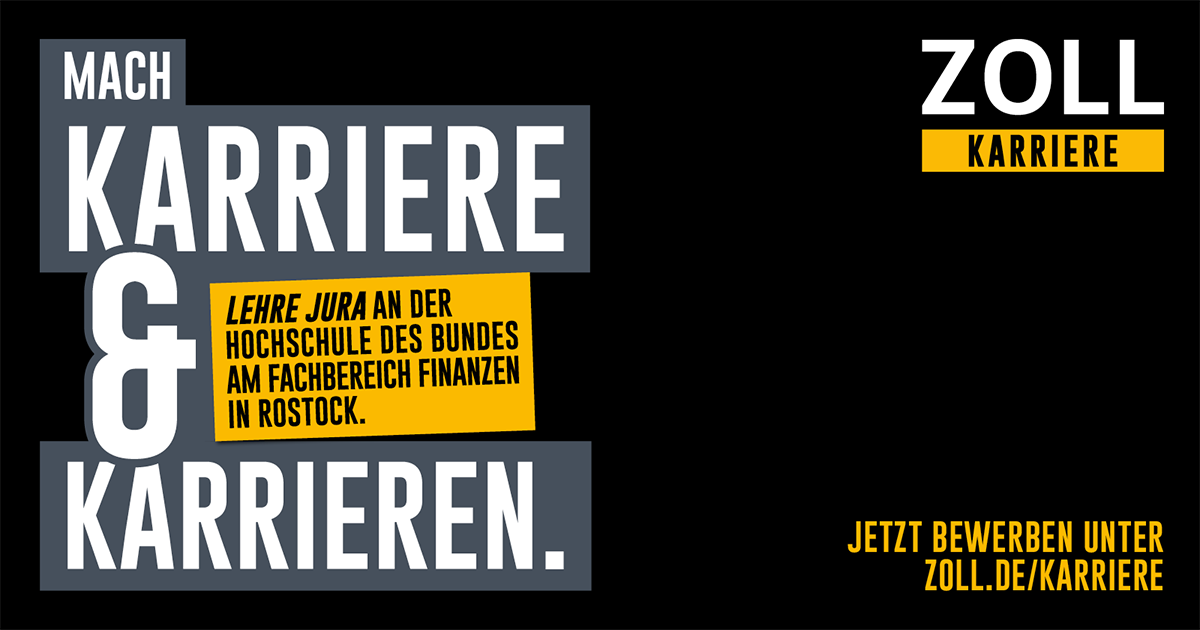Die Kölner Taxigenossenschaft hatte einem Mietwagenunternehmen, das über Uber X vermittelte Fahrgäste befördert, vorgeworfen, gegen die Rückkehrpflicht aus § 49 Abs. 4 S. 3 PBefG verstoßen zu haben. Danach muss ein Mietwagen nach Ausführung des Beförderungsauftrags "unverzüglich zum Betriebssitz zurückkehren, es sei denn, er hat vor der Fahrt vom Betriebssitz oder der Wohnung oder während der Fahrt einen neuen Beförderungsauftrag erhalten". Die Regelung soll verhindern, dass sich Mietwagenunternehmen taxiähnlich betätigen.
Wie schon zuvor das LG Köln bejahte auch das OLG Köln einen Unterlassungsanspruch der Taxigenossenschaft aus § 8 Abs. 1 UWG, da es sich bei der Rückkehrpflicht um eine Marktverhaltensregelung im Sinn des § 3a UWG handle und ein Verstoß dagegen unlauter sei (Urteil vom 09.05.2025 – 6 U 106/24). Anders als das Mietwagenunternehmen meine, sei die Rückkehrpflicht auch nicht verfassungs- und unionsrechtswidrig. Dass die Rückkehrpflicht verfassungskonform ist, hat das BVerfG bereits 1989 entschieden, worauf das OLG ausführlich eingeht. Danach dient die Rückkehrpflicht dem Schutz der Existenz- und Funktionsfähigkeit des Taxenverkehrs, an dem ein wichtiges Interesse der Allgemeinheit bestehe.
Staatsziel Umweltschutz stellt Verfassungsmäßigkeit nicht infrage
Das Mietwagenunternehmen hatte die Entscheidung des BVerfG für überholt gehalten, da mit den Leerfahrten infolge der Rückkehrpflicht erhebliche Umweltbelastungen verbunden seien. Es verwies auf Art. 20a GG, in dem der Umweltschutz als Staatsziel verankert ist. Das OLG hält entgegen, dass das BVerfG den Umweltschutz bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung bereits berücksichtigt habe. Durch die Staatszielbestimmung sah es die Verfassungsmäßigkeit der Rückkehrpflicht nicht infrage gestellt.
Das OLG sieht in der Rückkehrpflicht auch keinen Verstoß gegen Unionsrecht. Das Mietwagenunternehmen sah die Niederlassungsfreiheit verletzt (Art. 49 AEUV) und berief sich auf die "Barcelona"-Entscheidung des EuGH von 2023. Darin ging es um eine Regelung, nach der für Funkmietwagendienste im Großraum Barcelona eine (weitere) Lizenz erforderlich und die Anzahl der Lizenzen für Funkmietwagendienste auf ein Dreißigstel der für diesen Großraum gewährten Anzahl der Lizenzen für Taxidienste begrenzt war. Nach der EuGH-Entscheidung verstieß die Regelung gegen die Niederlassungsfreiheit.
"Barcelona"-Entscheidung des EuGH nicht übertragbar
Laut OLG ist diese Entscheidung aber nicht auf die Rückkehrpflicht für Mietwagen übertragbar. Die Regelung im Barcelona-Fall beschränke den Marktzugang, die Rückkehrpflicht beschränke hingegen die Berufsausübungsfreiheit. Dass die diese Beschränkung rechtfertigenden Gründe hinfällig seien, lasse sich nicht feststellen. Der EuGH betone in dem Urteil selbst, "dass die Mitgliedstaaten berechtigt sind, den Umfang und die Organisation ihrer Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu bestimmen, wobei sie insbesondere Ziele berücksichtigen können, die ihrer nationalen Politik eigen sind, und dass sie insoweit über ein weites Ermessen verfügen, das von der Kommission nur im Fall eines offenkundigen Fehlers in Frage gestellt werden kann".
Das OLG sah auch keine Veranlassung, den EuGH anzurufen, auch nicht mit Blick auf ein weiteres Urteil des EuGH von 2024, mit dem es die Rückkehrpflicht für Lkw gekippt hatte, die im EU-Mobilitätspaket enthalten war. Diese sei mit der Rückkehrpflicht für Mietwagen nicht vergleichbar. Außerdem habe der EuGH die Rückkehrpflicht für Lkw-Fahrer "bei hinreichender Verhältnismäßigkeitsprüfung gebilligt". Der EuGH hatte die Pflicht für nichtig erklärt, weil der Gesetzgeber nicht genügend Informationen hatte, um die Verhältnismäßigkeit beurteilen zu können.
Das Mietwagenunternehmen hatte auch gemeint, es sei nicht Anspruchsgegner, § 49 Abs. 4 S. 3 PBefG sei ein Sonderdelikt, das nur der Fahrer begehen könne. Das überzeugte das OLG nicht. Das Mietwagenunternehmen hafte außerdem auch für eingeschaltete Subunternehmer und deren Fahrer. Das ergebe sich sowohl aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 UWG als auch aus dessen Sinn und Zweck. Die Erfolgshaftung schließe eine Schutzlücke, die bestünde, wenn nur die allgemeine deliktsrechtliche Haftung des Unternehmers für seine Mitarbeiter eingriffe.