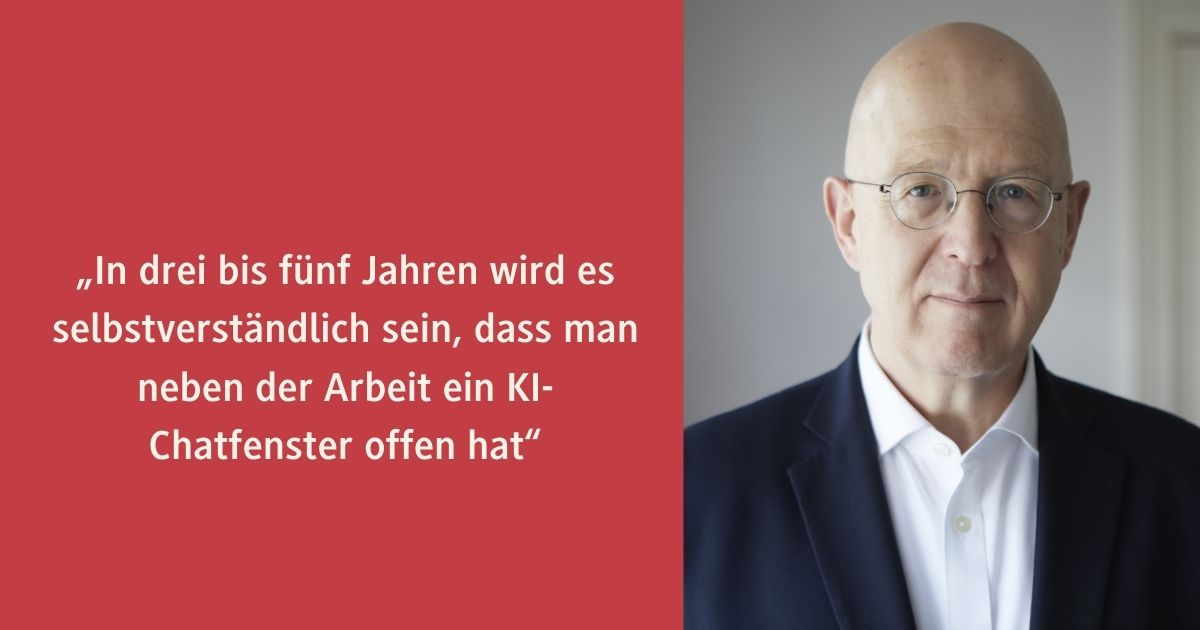beck-aktuell: Herr Hartung, Ende vergangener Woche sorgte ein LinkedIn-Post für Wirbel, in dem ein Anwalt einen Gerichtsbeschluss in einer Familiensache publik machte. Das AG Köln hatte darin deutliche Worte für einen Kollegen gefunden, der seinen Schriftsatz offenbar ungeprüft von einer KI hatte schreiben lassen und in dem sich zahlreiche falsche oder frei erfundene Fundstellen fanden. Das hat für Diskussionen gesorgt über den Einsatz von KI im Anwaltsberuf. Gibt es eigentlich Zahlen, wie viele Anwältinnen und Anwälte mittlerweile ihre Schriftsätze von KI schreiben lassen?
Markus Hartung: Nein, dazu gibt es keine Zahlen. Wir wissen aber, dass in den Massenverfahren, – wie im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal oder wegen Datenlecks – in denen Kanzleien hunderte oder tausende Kläger vertreten, regelmäßig Schriftsätze mithilfe von KI erstellt werden. Wenn eine Kanzlei in 500 Sachen Schriftsätze versendet, dann darf man sich nicht vorstellen, dass diese vorher im Manufakturbetrieb geschrieben und überprüft worden sind.
beck-aktuell: Kann man ganz allgemein sagen, wie sich anwaltliche Schriftsätze in Zeiten von generativer KI verändern? Werden sie besser oder schlechter?
Hartung: Nein, das kann man nicht pauschal sagen. Allerdings besteht ohnehin eine gewisse Tendenz, Schriftsätze immer länger und umfangreicher zu machen. Heutzutage muss man auch keine Schriftsätze mehr ausdrucken und zur Post bringen, sondern hat digitale Dateien, für deren Handling der Umfang unerheblich ist. Das mag die Bereitschaft erhöhen, auch viel zu schreiben. Offenbar besteht eine Tendenz, zu glauben: Je länger der Schriftsatz, desto besser.
beck-aktuell: Und diese Tendenz wird durch den Einsatz von KI befördert?
Hartung: Ja, weil Sie schon auf ganz viel Know-how und Text zurückgreifen können und vielleicht nicht den Mut haben, eine Sache wegzulassen. Dieser alte Spruch, weniger ist mehr, der gilt selten.
Aber es kommt auch praktisch etwas dazu: Sie haben als Anwalt immer die Sorge, die Balance richtig hinzubekommen zwischen dem, was Sie sagen müssen, um nicht in einer späteren Instanz damit präkludiert zu sein, und dem, wo man sagen müsste: Komm‘, das brauchen wir nicht, das ist selbstverständlich.
"In drei bis fünf Jahren wird es selbstverständlich sein, dass man neben der Arbeit ein KI-Chatfenster offen hat"
beck-aktuell: Nun gibt es sicherlich auch einen gewissen Druck auf Anwältinnen und Anwälte, KI einzusetzen. Viele fürchten, dass man in ein paar Jahren ohne KI gar nicht mehr mithalten könne. Sehen Sie das auch so?
Hartung: Die Frage ist ja, ob Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte KI einsetzen müssen, um ihren Pflichten aus einem Mandatsvertrag nachzukommen. Man könnte ja mal einen Schritt zurücktreten und sich fragen, ob man als Anwalt heute auf Online-Datenbanken verzichten und stattdessen nur seine Zeitschriften benutzen darf. Wenn dann etwas schief geht, müsste man sich möglicherweise vorhalten lassen, nicht alle technischen Möglichkeiten genutzt zu haben, um die maßgeblichen Quellen und Entscheidungen zu finden.
Ob sich das auf die Arbeit mit KI übertragen lässt, hängt sehr vom Sachgebiet ab. Wenn Sie in einer Due Diligence tätig sind, wo Sie sehr viele Dokumente überprüfen müssen, macht das heute niemand mehr händisch, sondern nur mit Software. Bei jemandem, der quasi nur im Manufakturbetrieb tätig ist – also ein Anwalt, der nur Einzelfälle bearbeitet – würde ich so eine Pflicht nicht sehen. Aber ein Anwalt, der sich diesen Entwicklungen und diesen Möglichkeiten verschließt, macht auf jeden Fall einen Fehler. Denn es wird in den nächsten drei bis fünf Jahren völlig selbstverständlich werden, dass man neben der Arbeit ein KI-Chatfenster offen hat. Wie man das nutzt, ist dabei eine andere Frage. Damit sind wir zurzeit noch alle unerfahren. Viele Leute nutzen diese Tools, ohne genau zu wissen, was die eigentlich können und was nicht und lassen sich blenden von den eleganten Formulierungen.
"Berufsrechtsdiskussionen auf LinkedIn wie 80 Millionen Bundestrainer"
beck-aktuell: Unter dem LinkedIn-Beitrag, mit dem ein Anwalt den Beschluss aus Köln öffentlich gemacht hatte, wurde auch diskutiert, ob solche Nachlässigkeiten gegen Berufsrecht, vor allem das Sachlichkeitsgebot, verstoßen. Sanktioniert das Berufsrecht gefälschte Literaturnachweise?
Hartung: Berufsrechtsdiskussionen auf LinkedIn haben etwas Skurriles. Das ist so, wie wenn plötzlich 80 Millionen Deutsche Fußball-Bundestrainer werden. Da haben sie dann 20.000 Leute, die Berufsrechtsspezialisten werden.
In erster Linie verstößt ein Anwalt gegen den Mandatsvertrag, wenn er so arbeitet. Das kann eine Aufsichtsbehörde, also eine Rechtsanwaltskammer, aber nur in sehr engen Grenzen sanktionieren. Die Annahme, es handele sich um einen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot nach § 43a Abs. 3 BRAO, halte ich dagegen für ein bisschen weit hergeholt.
beck-aktuell: Wenn nun immer mehr Anwältinnen und Anwälte auf KI zurückgreifen, muss dann das Berufsrecht die Zügel anziehen, um solche Auswüchse in Zukunft zu vermeiden?
Hartung: Wenn man solche Fälle sieht wie in Köln, könnte man geneigt sein, das zu denken. Man darf aber nicht übersehen, dass das Einzelfälle sind. Und deswegen muss man nicht gleich das Berufsrecht verschärfen.
Im Ausschuss 2 der Satzungsversammlung der Rechtsanwaltschaft – das ist das Gremium, welches die Berufsordnung für Rechtsanwälte beschließt und in dem ich Mitglied bin – überlegen wir, ob man einen Katalog verabschieden müsste, um die allgemeine Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung für den KI-Einsatz zu substantiieren. Es gibt außerdem schon eine Richtlinie der Bundesrechtsanwaltskammer zum Einsatz von KI in der Kanzlei, außerdem eine Richtlinie des Deutschen Anwaltsvereins. Ich glaube daher, wir kommen erst mal mit Erziehung und Hinweisen weiter, anstatt gleich an Sanktionen denken zu müssen.
"Die Justiz ist da noch nicht weit genug"
beck-aktuell: Nun stellt sich auch die Frage, was das für die Justiz bedeutet und wie man sich dort auf diese Entwicklung einstellen muss. Braucht die Justiz ihre eigene KI, um eine "Waffengleichheit" herzustellen?
Hartung: Die Justiz muss KI-mäßig viel besser ausgestattet werden. Es gibt zwar bereits viele Tools, die dort schon im Einsatz sind, vor allem in Massenverfahren. Da ist die Justiz inzwischen sehr weit, allerdings noch nicht weit genug, denn die KI setzt immer mindestens voraus, dass man schon die E-Akte im Einsatz hat, und das ist noch längst nicht überall der Fall.
beck-aktuell: Aus der Justiz gibt es schon seit Jahren die Forderung nach mehr Prozessstrukturierung, etwa über das viel zitierte Basisdokument für den Parteivortrag. Glauben Sie, dass dieses Thema durch die aktuelle Debatte um KI-Schriftsätze vielleicht nochmal Dynamik gewinnen könnte?
Hartung: Das würde ich mir wünschen. Ob das mit dem Basisdokument geschieht, was ja eine sehr spezielle Technik ist, oder man den Richterinnen und Richtern andere Strukturierungsmöglichkeiten an die Hand gibt, muss man sich überlegen.
Wenn aber nun die Online-Klageverfahren wirklich populär werden, dann wird es sicherlich auch irgendwann Verfahren geben, wo Sie Ihre Klage in eine bestimmte Maske eingeben. Zum Beispiel bei einer Mietsache oder in einem arbeitsrechtlichen Verfahren werden immer die gleichen Grundbehauptungen erhoben und das wird man für das Gericht durch Formulare und bestimmte Masken sicherlich vereinfachen und besser strukturieren können. Beispiele dafür gibt es in anderen Ländern zuhauf, in Deutschland hängen wir da noch ein bisschen zurück.
beck-aktuell: Herr Hartung, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit!
Markus Hartung ist Rechtsanwalt und Mediator in Berlin, Senior Fellow des Bucerius Center on the Legal Profession und Mitglied des Berufsrechtsausschusses des DAV.
Die Fragen stellte Maximilian Amos.
Das gesamte Gespräch hören Sie in der aktuellen Folge 61 von Gerechtigkeit & Loseblatt – Die Woche im Recht, dem Podcast von NJW und beck-aktuell.