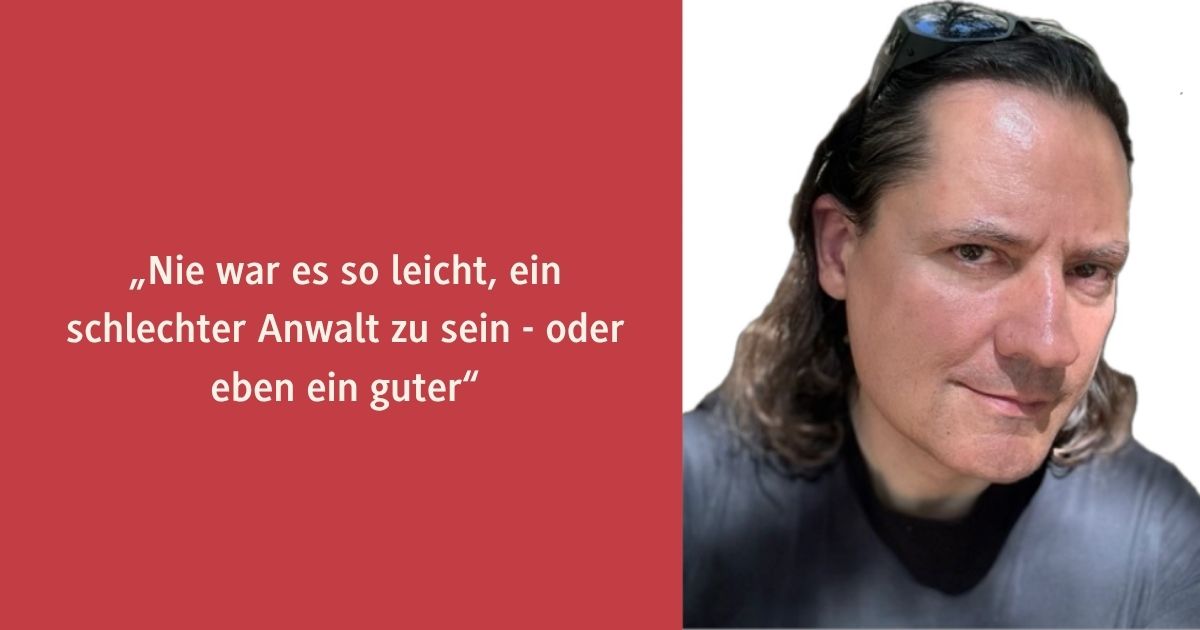beck-aktuell: Die Entwicklung im KI-Bereich geht derzeit rasant vonstatten und viele Anwältinnen und Anwälte, aber auch andere Menschen dürfte die Sorge plagen, bald abgehängt zu werden. Herr Braegelmann, gab es für Sie selbst mal einen Aha-Moment im Sinne von "Da passiert jetzt was"?
Tom Braegelmann: Mein erster Aha-Moment war etwa 2017. Damals habe ich als Legal Counsel bei einem KI-Startup gearbeitet und habe gesehen, dass Systeme aus unglaublich großen Vertragsmengen, 10.000 Seiten und noch mehr, tatsächlich Sachen herausfischen können, die wichtig sind. Da dachte ich erstmals: Das ist ja interessant, dass das geht!
Ganz konkret: Stellen Sie sich vor, ein großes Unternehmen hat 10.000 geleaste Autos oder Gabelstapler und der Gesetzgeber ändert das Bilanz-Recht und sagt: Ihr müsst die Vertragsdaten jetzt in eine Datenbank aufnehmen. Dann holen die Unternehmen normalerweise eine teure Kanzlei und die macht das für 700 Euro pro Stunde. KI kann die Vertragsinhalte aber auch sehr schnell herausfinden und in einer Tabelle darstellen. Das ging praktisch sofort. Der Aha-Moment war also doppelt: Erstens, die KI kann das. Zweitens, wir bräuchten keine KI in vielen Dingen, wenn wir einfach sorgfältig und ordentlich mit strukturierten Daten digital arbeiten würden.
Grundbuchauszüge als PDF: "Beispiel einer typisch deutschen Falschdigitalisierung"
beck-aktuell: Die KI als Co-Pilot, der die eigene Schlampigkeit in den Griff bekommt?
Braegelmann: Ganz genau. Die 40 Jahre technischen Schulden, die wir im deutschen Rechtssystem aufgehäuft haben, versuchen wir jetzt mit KI zu überbrücken. Konkretes Beispiel: Grundbuchauszüge gibt es heute immer noch so, wie zur Zeit des Erlasses der Grundbuchordung 1897, nur inzwischen als PDF. Das ist für mich ein Beispiel einer typisch deutschen Falschdigitalisierung, nur das Papier durch PDFs ersetzen. In anderen Ländern sind das Datenbanken. In Deutschland müsste ich erstmal das PDF lesen und die Information selbst finden. Aber jetzt können KI-Programme diese Grundbuchauszüge lesen.
beck-aktuell: Das Problem der PDF-Dokumente kennen ja auch Gerichte und Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten…
Braegelmann: Ja, zum Beispiel bei einer Verbraucherinsolvenz. Der Antrag kommt auf Papier oder als PDF bei Gericht an und wandert von dort an den Insolvenzverwalter. Der kann das Dokument jetzt zumindest von der KI auslesen lassen und ein Mensch validiert es am Ende nur noch. So wird Zeit gespart. Doch der Fehler liegt am Anfang: Man könnte einfach direkt alles in eine Datenbank eintragen.
"Noch nie so leicht wie heute, ein schlechter Anwalt zu sein - oder ein guter"
beck-aktuell: Welche Verwerfungen wird der Anwaltsmarkt durch KI erleben?
Braegelmann: Sowohl große Kanzleien als auch kleine Kanzleien sind betroffen. Ich weiß aus Anekdoten, dass viele kleine Kanzleien recht robust ChatGPT einsetzen, was datenschutzrechtlich, berufsrechtlich und sogar strafrechtlich aufgrund von § 203 StGB problematisch sein kann, der Berufsgeheimnisträgern wie Anwälten untersagt, vertrauliche Daten unbefugt weiterzugeben. Diese Kanzleien packen aber einfach manchmal alle Daten in den KI-Chatbot, ohne dafür eine berufsrechtliche und damit strafrechtliche Erlaubnis zu haben, denn dafür müssten sie den KI-Anbieter über seine Pflichten vertraglich belehren; das machen die amerikanischen Anbieter nicht mit. Es gibt aber deutsche Anbieter, die das mitmachen.
beck-aktuell: So etwas kann auch schnell auffliegen, etwa, wenn die KI halluziniert, wie neulich in einem Fall vor dem AG Köln, als sich ein Anwalt mit erfundenen Fundstellen blamierte.
Braegelmann: Das kann natürlich passieren, aber guten Anwälten passiert so etwas nicht. Es ist ohnehin so: Gute Anwälte sind auch mit KI gut, schlechte Anwälte trotzdem schlecht. Ich sage gerne scherzhaft: Dank KI war es noch nie so leicht wie heute, ein schlechter Anwalt zu sein. Aber eben auch ein guter.
Große Kanzleien hingegen müssen sich an viele zusätzliche Vorschriften – Insiderthematiken, etc. – halten und haben zudem ein Reputationsrisiko. Sie müssen also streng darauf achten – eigentlich wie alle anderen – ausschließlich rechtskonform KI einzusetzen. Sie werden aber Schwierigkeiten bekommen, was ihre juristische Fleißarbeit angeht, denn KI kann viele Arbeiten übernehmen, die früher Anwälte erledigen mussten, die dafür gut bezahlt wurden. Jetzt können KI-Tools wie Gemini massenhaft Verträge so ändern, wie ein Partner in der Kanzlei das erwartet. Allerdings wissen das eben auch die Mandanten – und werden für diese Fleißarbeit nicht mehr zu zahlen bereit sein.
Was meiner Meinung nach auch kommen wird, ist, dass spätestens nächstes Jahr alle großen Kanzleien ihren Mandanten werden versprechen müssen, dass die Arbeit von jungen Anwälten erst von der KI überprüft wird, bevor ein Partner sich das anschaut.
"Anwälte sollten zweigleisig fahren"
beck-aktuell: Wo sehen Sie auf der anderen Seite die Potenziale von KI für Anwältinnen und Anwälte?
Braegelmann: Das ist eines der Potenziale: KI kann helfen, Fleißarbeit zu reduzieren und effizienter zu arbeiten, die redaktionelle Überprüfung von Verträgen ist ein perfektes Beispiel. KI kann diese Aufgabe vorbereitend übernehmen und Änderungen automatisch vornehmen, was viel Zeit spart und die Qualität der Arbeit verbessert. Außerdem kann sie helfen, schneller und besser zu schreiben, gerade bei Alltagsarbeit. Ganz wichtig bei alledem: Der Mensch muss alles noch einmal überprüfen. Aber das war ja vorher auch schon so, ist in dem Sinne eigentlich gar nicht neu und ändert nicht den Sorgfalts-Maßstab der Anwaltschaft.
beck-aktuell: Haben Sie eine Lieblings-KI, die Sie nutzen?
Braegelmann: Momentan nutze ich gerne Google Gemini 2.5. Es ist sehr leistungsfähig und integriert sich gut in bestehende Systeme. Ich vergleiche regelmäßig verschiedene KIs, um die beste Leistung zu finden. Allerdings ist es im Moment nicht zulässig, dort mandatsbezogene Daten hochzuladen, deswegen sollte man immer einen der verschiedenen guten deutschen Anbieter dazunehmen.
beck-aktuell: Welche Tools können Sie Anwältinnen und Anwälten empfehlen?
Braegelmann: Sie sollten zweigleisig fahren: Amerikanische Angebote wie ChatGPT, Perplexity und eben Gemini 2.5 Pro sind unglaublich gut für die Websuche und das Erstellen von Argumentationen oder das Zusammenstellen von Rechtsprechungsübersichten und dergleichen. Proprietäre Anbieter wie Beamon AI, Libra und Prime Legal oder Legora und Harvey bieten Rechtskonformität und sind partiell an echte juristische Datenbanken angebunden, letzteres fehlt bei den generellen Chatbots aus den USA. Die Datenbank beck-online (Anm. d. Red: beck-online gehört wie beck-aktuell zum Hause C.H. Beck) bietet bereits mehrere KI-Chatbots, der Legal AI Workspace Beck-Noxtua steht kurz vor dem Launch. Die Herausforderung für die meisten Kanzleien wird die Integration der Tools in bestehende Systeme sein.
"Wir werden eine Wende zum Besseren erleben"
beck-aktuell: Wie sieht es mit der Anwendung von KI in der Justiz aus? Sehen Sie auch hier eine Möglichkeit, angesichts der Versäumnisse in der Digitalisierung nun technologische Abkürzungen zu nehmen?
Braegelmann: Ja, das müssen wir, weil es so nicht weitergehen kann. Und ich denke, wir werden eine Wende zu einer dank moderner Technik wirklich besseren Justiz erleben. Auch in Deutschland wird es besser werden. KI wird ja bereits in der Justiz eingesetzt, um etwa große Bauprozesse zu verwalten und Akten zu durchsuchen oder intern eine Übersicht über alle Entscheidungen zu haben, die im Gericht vorliegen. Das OLG Koblenz ist da zum Beispiel ganz weit vorne mit moderner Technik. Sie hilft , den Überblick zu behalten und effizienter zu arbeiten. Aber ganz klar: Da kommt noch viel mehr. Und zwar nicht nur im Sinne einer Reparaturmaßnahme, um bspw. personelle Engpässe aufzufangen.
Nehmen wir zum Beispiel das Dauerthema des strukturierten Sachvortrags, den sich die Justiz seit langem wünscht: Hier könnte KI die anwaltlichen Schriftsätze für den Richter vorsortieren. In manchen Sachen geht das nicht, wie bei einem komplizierten Gesellschafterstreit. Aber KI kann in einfacheren Verfahren heute schon eine Relationstabelle erstellen, ohne dass sie mit anwaltlichen Schriftsätzen trainiert worden wäre.
beck-aktuell: Dürfen Anwältinnen und Anwälte sowie Rechtsuchende dann künftig auf zügigere Verfahren hoffen?
Braegelmann: KI wird die Arbeit in der Justiz effizienter machen, weil sie große Datenmengen schneller und präziser verarbeiten kann. Das wird dazu führen, dass Fälle schneller abgeschlossen werden und die Arbeitsbelastung für Richterinnen und Anwälte reduziert wird. Sie kann im Übrigen auch dazu beitragen, dass die Justiz transparenter und zugänglicher wird, indem sie komplexe rechtliche Informationen verständlicher macht.
beck-aktuell: Was sind die nächsten "Big Things" in der KI-Entwicklung?
Braegelmann: ChatGPT 5 und Gemini 3 könnten einen echten Wechsel bringen. Wenn Google ein berufsrechtskonformes Produkt anbieten sollte, könnte das den Rechtsmarkt stark verändern. Mehr rechtskonforme Angebote, die günstig zu haben und in die normale IT integriert sind, werden aber kommen. Und KI wird besser darin werden, die Wirklichkeit zu lesen und zu erkennen. Good times ahead. Die größte Hürde wird übrigens sein, die moderne KI in die bisherigen IT-Systeme zu integrieren, das wird sehr viel Arbeit erfordern.
beck-aktuell: Herr Braegelmann, vielen Dank für das Gespräch!
Tom Braegelmann, LL.M. (Cardozo), ist Rechtsanwalt bei Annerton und hält regelmäßig Vorträge zum KI-Einsatz in Anwaltskanzleien.
Die Fragen stellte Dr. Hendrik Wieduwilt.
Das Gespräch in voller Länge hören Sie in der aktuellen Folge 62 von Gerechtigkeit & Loseblatt, dem Podcast von NJW und beck-aktuell.