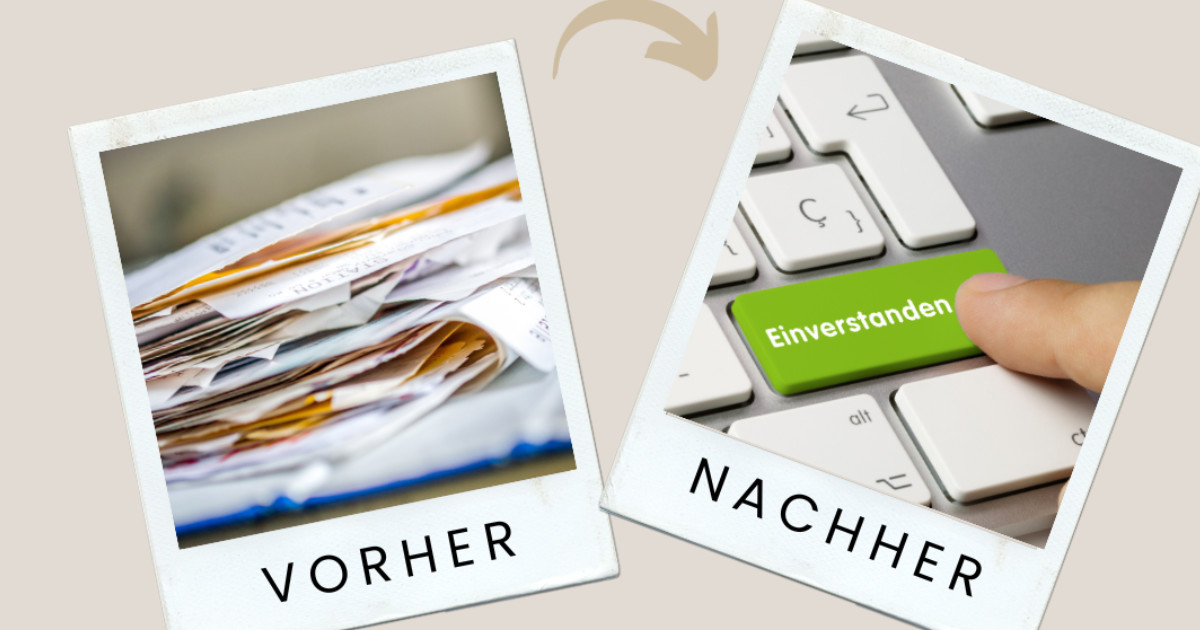"Die Steuer macht jetzt das Amt!" – dieser Slogan klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, ist aber Realität in Kassel. Seit August dieses Jahres erprobt das dortige Finanzamt etwas, wovon Millionen Deutsche träumen: Sie bekommen einfach einen fertigen Steuerbescheid-Vorschlag zugeschickt, ohne selbst auch nur einen Finger krumm machen zu müssen. Kein stundenlanges Wälzen von Belegen, kein Grübeln über absetzbare Werbungskosten, kein Fluch über das ELSTER-Portal. Stattdessen nur eine simple Frage: Sind Sie einverstanden?
Was nach einer digitalen Revolution klingt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als juristischer Drahtseilakt. Denn die scheinbar so einfache Zustimmung zu einem behördlichen Vorschlag wirft fundamentale Fragen auf: Wer macht hier eigentlich die Steuererklärung – das Amt oder der Bürger? Und wie lässt sich das mit unserem jahrhundertealten System der Mitwirkungspflichten vereinbaren?
Neues Projekt – wer darf mitmachen?
Das Finanzamt Kassel führt seit August ein deutschlandweit einmaliges Pilotprojekt durch, bei dem ausgewählte Steuerpflichtige automatisch einen Vorschlag für die Festsetzung der Einkommensteuer 2024 erhalten, ohne zuvor eine eigene Steuererklärung abgeben zu müssen. Das Projekt basiert auf der Erkenntnis, dass der Steuerverwaltung aufgrund gesetzlich verankerter Meldepflichten bereits zahlreiche steuerrelevante Informationen elektronisch vorliegen, etwa über Lohn, Rente und Versicherungen. Anstelle der üblichen formellen Erinnerung zur Abgabe der Steuererklärung erhalten die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger einen konkreten Vorschlag für ihren Steuerbescheid, den sie lediglich prüfen müssen. Das Verfahren soll die traditionelle Steuererklärung für bestimmte Fallkonstellationen überflüssig machen und das Konzept "Steuerverwaltung neu gedacht" der hessischen Finanzverwaltung praktisch umsetzen.
Das Pilotprojekt richtet sich an eine spezifisch ausgewählte Gruppe von Steuerpflichtigen im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Kassel. Die Teilnehmer müssen folgende Kriterien erfüllen:
- Erklärungspflicht: Sie sind zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet.
- Keine steuerliche Beratung: Sie werden nicht steuerlich vertreten oder beraten.
- Vollständige Datenlage: Ihre Steuerdaten liegen dem Finanzamt mutmaßlich bereits vollständig vor.
- Nicht abgegebene Erklärung: Sie hatten ihre Einkommensteuererklärung für 2024 bis zum 31. Juli 2025 noch nicht eingereicht.
Die Datengrundlage umfasst alle relevanten Steuerdaten wie Arbeitslohn, Renten und Sozialversicherungsbeiträge, die der hessischen Steuerverwaltung von Dritten (Arbeitgeber, Renten- und Krankenversicherung) elektronisch übermittelt wurden.
Wie die Steuererklärung vom Amt funktioniert
Das Finanzamt prüft zunächst, ob alle erforderlichen Steuerdaten vollständig vorliegen. Bei vollständiger Datenlage erstellt das Finanzamt einen Vorschlag für die Einkommensteuerveranlagung und versendet diesen per Post an die betreffenden Steuerpflichtigen. Die Empfänger haben dann vier Wochen Zeit, um diesen zu prüfen. Sind sie mit dem Vorschlag einverstanden, müssen sie nichts weiter unternehmen.
Der Vorschlag basiert auf den gesetzlichen Pauschbeträgen, wie beispielsweise dem Werbungskostenpauschbetrag. Steuerpflichtige können innerhalb der vierwöchigen Frist noch zusätzliche Aufwendungen wie Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen geltend machen oder sogar eine ganze eigene Steuererklärung vorlegen, wenn sie mit dem Vorschlag nicht einverstanden sind. Geschieht das nicht, erlässt das Finanzamt Kassel nach Ablauf der Frist automatisch einen Einkommensteuerbescheid auf Basis des Vorschlags.
Eine eigene Einkommensteuererklärung abgeben müssen weiterhin jedoch alle, die im Jahr 2024 noch andere erklärungspflichtige Einkünfte bezogen haben. Auch bei fehlerhaften oder fehlenden Daten oder unzutreffenden persönlichen Verhältnissen (Familienstand, Zusammenveranlagung, Berücksichtigung von Kindern) müssen die Steuerpflichtigen selbst ran. Die vorsätzliche oder fahrlässige unvollständige oder unrichtige Angabe von Einkünften kann schließlich eine Steuerhinterziehung nach § 370 AO oder leichtfertige Steuerverkürzung nach § 378 AO darstellen und entsprechende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Nach erfolgreichem Abschluss des Pilotprojekts plant die hessische Steuerverwaltung, den Service über Kassel hinaus hessenweit anzubieten. Voraussetzung ist, dass die Steuerdaten der betreffenden Bürgerinnen und Bürger ausweislich der Analyse vergangener Veranlagungsverfahren vollständig vorliegen. Inwiefern die Steuererklärung vom Amt weiter Schule machen wird, ist nach Aussage des hessischen Finanzministers von gemeinsamen Fortschritten bei den Themen Typisierung und Pauschalierung abhängig. Diese Aspekte werden derzeit zwischen den Ländern und dem Bundesfinanzministerium (BMF) diskutiert, was darauf hindeutet, dass man das Konzept gerne auch bundesweit ausweiten würde. Das Pilotprojekt fügt sich in die breiteren Digitalisierungsbemühungen der öffentlichen Verwaltung ein und stellt einen konkreten Baustein zur Entbürokratisierung und Serviceorientierung der Steuerverwaltung dar.
Zustimmung statt Steuererklärung: Die rechtliche Gratwanderung des Pilotprojekts
Das Projekt wirft jedoch ein paar rechtliche Fragen auf, vor allem, wie die Zustimmung zu dem behördlichen Veranlagungsvorschlag rechtlich zu qualifizieren ist. Die Steuerpflichtigen werden mit ihrer Einverständniserklärung von der Abgabepflicht einer vollständigen Einkommensteuererklärung befreit. Das Einverständnis stellt also keine Steuererklärung im Sinn des §§ 149 f. AO dar. Zudem ist ausschließlich das BMF gemäß § 51 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. b EStG ermächtigt, im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder Vordrucke für die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung zu bestimmen. Die Veranlagung vom Amts wegen könnte zwar vielleicht nach § 150 Abs. 7 AO legitimiert sein. Dieser setzt allerdings Steuererklärungen, die nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgegeben oder nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelt werden, voraus. Weitere Normen kommen – soweit ersichtlich – nicht in Betracht.
Allerdings könnte ein aktuelles Projekt des BMF einen möglichen Lösungsansatz bieten, um die juristischen Klippen zu umschiffen. Die Initiative befasst sich seit dem Jahr 2018 mit einer vereinfachten Steuererklärung für Rentnerinnen und Rentner. Teilnehmende Bundesländer sind Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Gemäß dem Vordruck zur Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften für das Jahr 2024 kann die Einkommensteuer anhand der elektronisch vorliegenden Daten festgesetzt werden, wenn keine Einkünfte vorliegen außer inländischen Renten- bzw. Pensionseinkünften und Kapitaleinkünften, die bereits abgeltend besteuert wurden oder für die der Sparer-Pauschbetrag mittels Freistellungsauftrag in Anspruch genommen wurde. Neben den elektronisch übermittelten Daten können Steuerpflichtige ausgewählte Aufwendungen, beispielsweise nicht elektronisch übermittelte Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen geltend machen.
In dem aktuellen Vordruck ist unmittelbar vor der Unterschriftszeile folgender Hinweis platziert:
"Diese Erklärung ist eine Einkommensteuererklärung im Sinne des § 150 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 25 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Die mit der Erklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 und 150 AO und der §§ 25 und 46 EStG erhoben."
Insoweit ist dieser Service eindeutig als eigene Steuererklärung zu qualifizieren.
Für das hessische Projekt könnte diese Formulierung beispielsweise angepasst lauten:
"Die von Ihnen abgegebene Zustimmung des behördlichen Vorschlags gilt als eine Einkommensteuererklärung im Sinne des § 150 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. § 25 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Die angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 und 150 AO und der §§ 25 und 46 EStG erhoben."
Hessen wagt ein mutiges Experiment
Das hessische Experiment zeigt exemplarisch, wie sich der deutsche Rechtsstaat in Zeiten der Digitalisierung neu erfinden muss. Die rechtliche Konstruktion eines Zustimmungsvorschlags mag elegant erscheinen, offenbart aber ein grundsätzliches Dilemma: Je bürgerfreundlicher die Verwaltung wird, desto kreativer muss sie mit bestehenden Rechtsnormen auslegen oder neue Regelungen schaffen.
Vielleicht liegt in dieser scheinbaren Schwäche aber auch die größte Stärke des Projekts. Denn während andere Länder ihre Steuersysteme von Grund auf reformieren mussten, beweist Hessen, dass auch innerhalb des bestehenden Rechtsrahmens bemerkenswerte Innovationen möglich sind. Die Frage ist nur: Wird der BFH das genauso sehen? Spätestens wenn der erste Steuerpflichtige gegen seinen automatisch erstellten Bescheid klagt, wird sich zeigen, ob Hessens kreativer Umgang mit der Mitwirkungs- und Erklärungspflicht vor Gericht Bestand hat.
Bis dahin bleibt das Pilotprojekt das, was es von Anfang an ist: ein mutiges Experiment an der Grenze zwischen Innovation und Rechtssicherheit. Und vielleicht ist genau das der Preis für den Fortschritt – die Bereitschaft, ausgetretene Pfade zu verlassen, auch wenn das Ziel noch nicht ganz klar zu erkennen ist.
Prof. Dr. Christoph Schmidt ist Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Weiterhin gründete er das Institut für digitale Transformation im Steuerrecht (IdTStR) an der gleichen Hochschule und leitet dieses seit März des Jahres 2023.