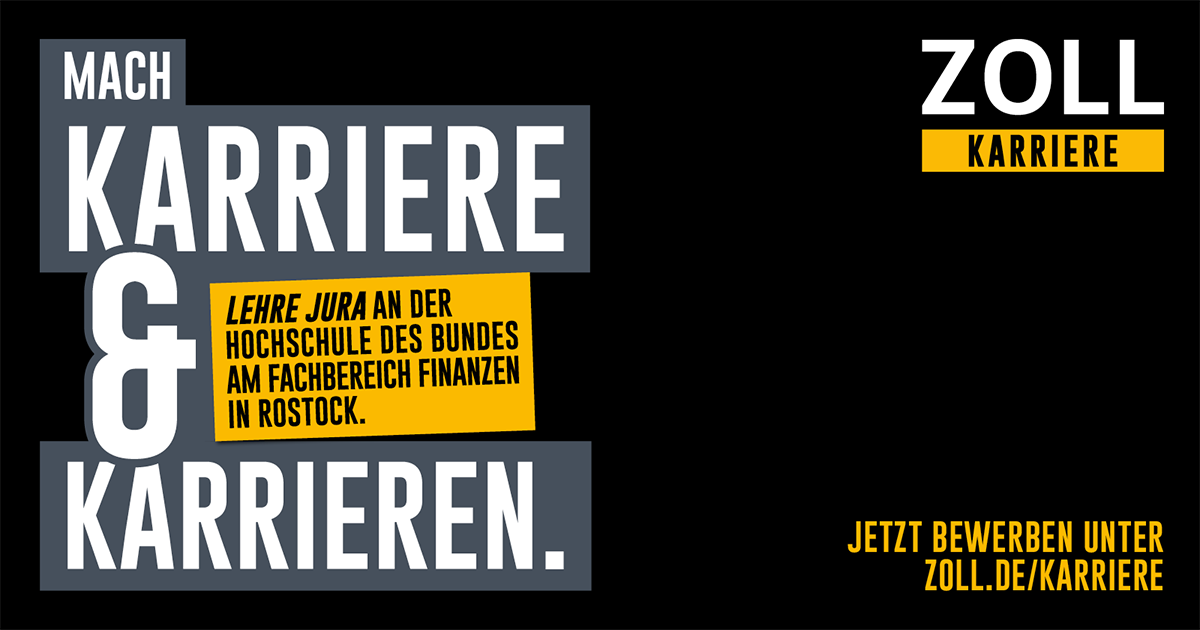Das BVerwG hat klargestellt, dass inlandsbezogene Belange wie das Wohl eines Kindes und familiäre Bindungen nicht zu einem nationalen Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG führen können. Diese Aspekte seien lediglich im Rückkehrverfahren zu berücksichtigen, so die Leipziger Richterinnen und Richter (Urteil vom 22.05.2025 – 1 C 4.24 u.a.). Damit hob das Gericht diverse Urteile des VG Gelsenkirchen teilweise auf und verwies die Sachen zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung zurück.
Mehrere ausländische Familien hatten Asylanträge gestellt, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgelehnt wurden. Das BAMF stellte fest, dass keine Abschiebungsverbote vorlägen, und drohte den Familien die Abschiebung an. Das VG Gelsenkirchen verpflichtete die Bundesrepublik in allen Fällen, festzustellen, dass für die jeweiligen Familien ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliege. Es argumentierte, dass nach Art. 5 Halbs. 1 Buchst. a und b der sogenannten Rückführungsrichtlinie (RL 2008/115/EG) das Wohl des Kindes und die familiären Bindungen in allen Stadien des Verfahrens berücksichtigten werden müssten.
Wer muss sich um familiäre Bindungen in Deutschland kümmern?
"In dem Verfahren ging es darum, wie sich die Rechtsprechung des EuGH auf die Prüfung des asylrechtlichen Schutzes in Deutschland auswirkt" erklärt der Migrationsrechtler Constantin Hruschka von der Evangelischen Hochschule Freiburg den Hintergrund gegenüber beck-aktuell. Hruschka spricht ein Urteil des EuGH vom 15.02.2023 (C-484/22) an, in dem der Gerichtshof feststellte, dass die deutsche Praxis, dass eine Person, die aus humanitären oder familiären Gründen nicht abgeschoben werden kann, weil ihre Familie in Deutschland ist, eine Duldung erhält, unionsrechtswidrig sei. "Der EuGH hat dabei ausgeführt, dass bereits die Abschiebungsandrohung nicht ergehen darf, wenn klar ist, dass die Person bleiben darf, da eine Rückkehrentscheidung unterbleiben muss."
Das führte in der deutschen Behördenorganisation allerdings zu der Frage, wer sich mit diesen familiären Bindungen im Inland befassen musste. Denn die Prüfung zielstaatsbezogener Gründe war Aufgabe des BAMF, während vor der EuGH-Entscheidung die Prüfung inlandsbezogener Vollstreckungshindernisse den dafür sachnäheren Ausländerbehörden zukam. Das BAMF erließ also eine Abschiebungsandrohung, ohne dabei innerstaatliche Vollstreckungshindernisse oder das Kindeswohl zu beachten, und überließ dies den Ausländerbehörden. Infolge der EuGH-Rechtsprechung entschied sich der Gesetzgeber dann, dem BAMF auch die Prüfung inlandsbezogener Abschiebehindernisse vor Erlass einer Abschiebungsandrohung zu übertragen.
In den Verfahren, die nun in Leipzig zu entscheiden waren, ging es darum, ob nach dieser Rechtslage auch Menschenrechtsverletzungen, die mit Sachverhalten in Deutschland zu tun haben – etwa, wenn eine familiäre Gemeinschaft auseinandergerissen wird – ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG begründen können. Das BVerwG widersprach dem nun und führte aus, dass § 60 Abs. 5 AufenthG auf die EMRK verweise, soweit sich aus dieser Abschiebungsverbote ergäben, die auf Gefahren im Zielland der Abschiebung beruhten. Inlandsbezogene Belange erfasse die Verweisung im AufenthG nicht. Diese Belange seien erst im Rückkehrverfahren – also von den Ausländerbehörden – zu berücksichtigen.
Chance verpasst, Konflikt mit dem EuGH voraus
Damit habe das BVerwG "die Möglichkeit verpasst, die deutsche Rechtslage mit der europäischen stärker in Einklang zu bringen", kritisiert Hruschka. "Die Chance auf eine Vereinfachung und größere Verständlichkeit der BAMF-Verfahren wurde damit vorerst verpasst, obwohl es sich angeboten hätte, die Prüfung und Entscheidung, ob nach Art. 6 Abs. 4 der Rückführungsrichtlinie keine Abschiebungsandrohung erlassen werden darf, einheitlich und unter Abwägung aller zielstaatsbezogenen und inlandsbezogenen Sachverhalte als einheitliche Entscheidung zu verstehen." Das BVerwG habe damit auch einen potenziellen Konflikt mit dem EuGH in Kauf genommen, meint der Migrationsrechtler. Dieser werde absehbar von einer einheitlichen Entscheidung ausgehen, sollte ihm die Frage noch einmal vorgelegt werden.
In den Gelsenkirchener Verfahren geht es nun wieder zurück auf Null. Da dem BVerwG als Revisionsgericht in den jeweiligen Verfahren tatsächliche Feststellungen zu zielstaatsbezogenen Abschiebungsverboten fehlten, konnte er nämlich nicht beurteilen, ob die Familien nach ihrer Rückkehr in ihre Herkunftsländer in eine Lage geraten würden, die gegen Art. 3 EMRK verstieße oder ob sie dort einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit ausgesetzt wären. Das muss nun das VG klären.