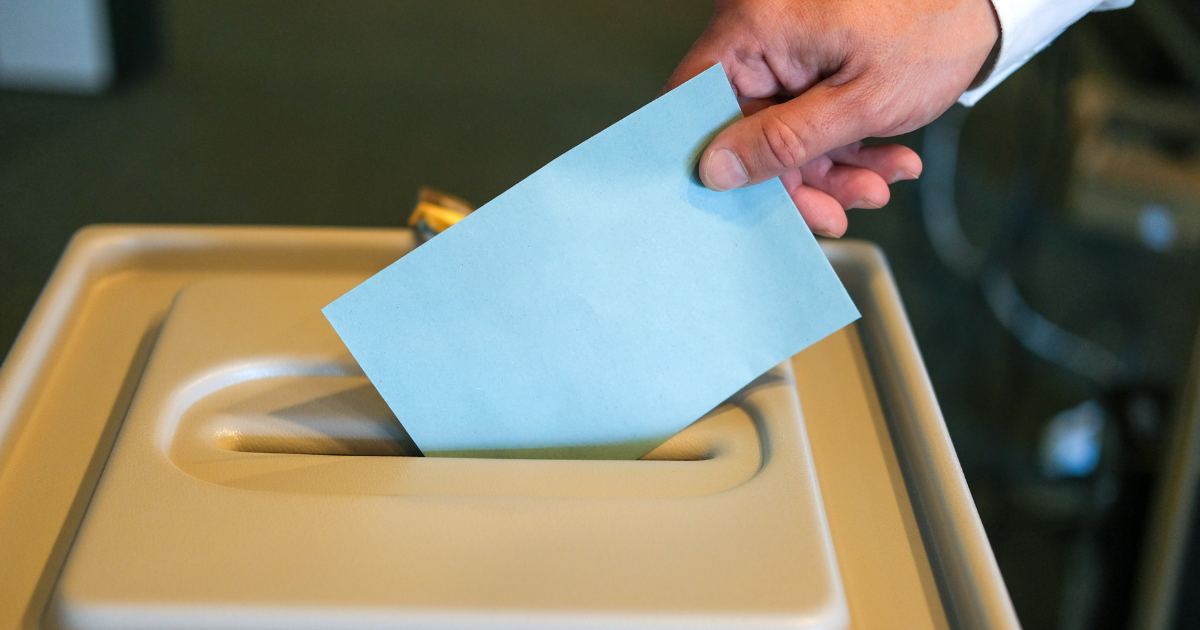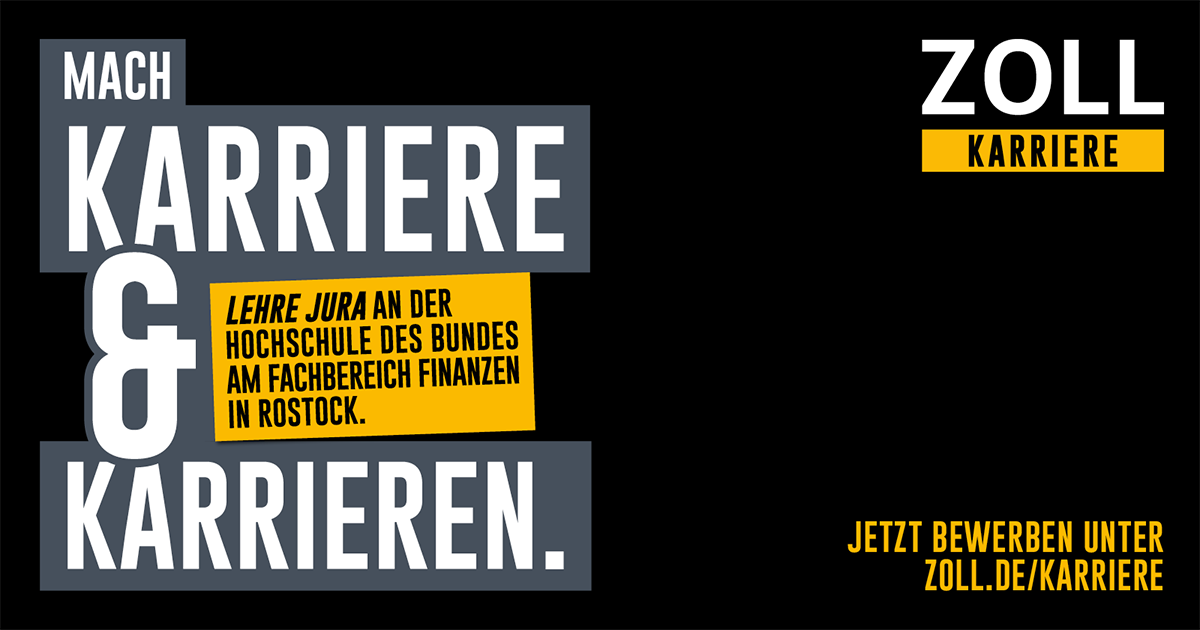Matrixstrukturen sind heute aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken. Gerade in der IT-Branche wird vielfach in Strukturen jenseits der klassischen örtlichen Betriebe zusammengearbeitet. Mitarbeitende werden von einer Führungskraft geführt, die selbst an einem anderen Ort sitzt – aber im selben Unternehmen arbeitet oder sogar bei einem anderen Konzernunternehmen angestellt ist.
In der arbeitsrechtlichen Praxis stoßen diese Formen der überörtlichen Zusammenarbeit auf das im BetrVG verankerte Prinzip der "ortsnahen Interessenvertretung". Der Betrieb im Sinne des BetrVG wird grundsätzlich von der örtlichen Struktur aus gedacht. Ein Betriebsrat ist damit im Ausgangspunkt zunächst für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Standorts zuständig, an welchem er gewählt wurde. Was aber, wenn ein Arbeitnehmer in Berlin sitzt, aber in Dortmund ein Team führt, während seine eigene Führungskraft in München sitzt? Diese Konstellationen werden bei Einstellung und Versetzung, aber auch im Rahmen der Betriebsratswahlen Fragen auf.
Das BAG hatte sich nun vertieft mit der Frage zu beschäftigten, ob Matrix-Führungskräfte bei der Betriebsratswahl in dem Betrieb, in dem sie Mitarbeiter führen, mit zu berücksichtigen sind (Beschluss vom 22.05.2025 – 7 ABR 28/24). Konkret ging es um die Frage der Wahlberechtigung von Matrix-Führungskräften, die in dem Betrieb, in dem gewählt wird, Mitarbeitende führen, selbst aber einem anderen Standort zugeordnet sind und teilweise aus dem Homeoffice arbeiten. Dass es sich hierbei um eine wichtige, praxisnahe Frage handelt, zeigen bereits die Größenverhältnisse: In die Wählerliste waren neben 498 Arbeitnehmern des Betriebs weitere 128 Führungskräfte eingetragen. Die Frage, ob diese Führungskräfte nun in sämtliche Wählerlisten aller Betriebe, in denen sie Mitarbeitende führen, einzutragen sind, ist daher von erheblicher Bedeutung. Dies würde die jeweilige Betriebsgröße – im Verhältnis zu der Anzahl der tatsächlich im Unternehmen arbeitenden Köpfe – enorm aufblähen.
LAG widersprechen sich
Zu dieser Frage gibt es bereits zwei LAG-Entscheidungen, die sich im Ergebnis widersprechen, sodass die Entscheidung des BAG mit Spannung erwartet wurde. Das LAG Hessen hatte hier letztlich einen weiten Eingliederungsbegriff vertreten: Gehörten einem Unternehmen mehrere Betriebe an und werde ein Arbeitnehmer in mehreren Betrieben eingesetzt – wofür die Wahrnehmung von fachlichen Führungsaufgaben zur Erledigung der Aufgaben des Betriebs typischerweise ausreiche – so erwerbe dieser Arbeitnehmer die Zugehörigkeit zu jedem dieser Betriebe und sei dort wahlberechtigt (Beschluss vom 22.01.2024 – 16 TaBV 98/23; anhängig beim BAG unter dem Az. 7 ABR 7/24). Dies bedeutet, dass eine Matrix-Führungskraft in jedem Betrieb, in dem auch nur ein von ihr geführter Arbeitnehmer sitzt, wahlberechtigt wäre und bei der Betriebsgröße mitzählen würde.
Das LAG Baden-Württemberg hatte in der Entscheidung, die nun dem BAG zur Überprüfung vorlag, hingegen den Eingliederungsbegriff auf seinen Kern zurückgeführt. Eine Matrix-Führungskraft sei regelmäßig (nur) in ihrem "Stammbetrieb" wahlberechtigt, das heißt in dem Betrieb, dem sie arbeitsvertraglich zur regelmäßigen Arbeitsleistung zugeordnet sei (Beschluss vom 13.06.2024 – 3 TaBV 1/24).
Das LAG Baden-Württemberg hat dabei betont, dass die Matrix-Führungskräfte in die einzelnen Betriebe, in denen sie Mitarbeitende führen, zwar i.S.d. § 99 BetrVG eingegliedert seien. Dies bedeute, dass jeder einzelne Betriebsrat eines Betriebs, in dem Mitarbeitende geführt werden sollen, vor der Einstellung eines Matrix-Managers zu beteiligen ist. Es führt aber aus, dass der Eingliederungsbegriff des § 7 S. 1 BetrVG, der die Wahlberechtigung regelt, davon zu unterscheiden sei. Das LAG Baden-Württemberg beleuchtet dabei insbesondere den Sinn und Zweck der verschiedenen Normen: § 99 BetrVG diene dem Schutz der im Betrieb Beschäftigten, während § 7 BetrVG gewährleiste, dass diejenigen über die Zusammensetzung des Betriebsrats mitentscheiden dürften, deren Interessen er wahrnehme.
BAG: Einheitlicher Eingliederungsbegriff
Der 7. Senat des BAG ist der Linie des LAG Hessen gefolgt. Es hat daher die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. Da er aber eine weitere Sachverhaltsaufklärung hinsichtlich der Frage für notwendig erachtet, ob die Matrix-Führungskräfte in dem konkreten Fall tatsächlich in den Betrieb eingegliedert sind, hat er die Sache an das LAG zurückverwiesen.
Dabei betont das BAG insbesondere, dass es für einen Arbeitnehmer durchaus möglich sei, in mehrere Betriebe eingegliedert zu sein. Eine solche Mehrfach-Eingliederung führe dann in der Konsequenz zu einer Mehrfach-Wahlberechtigung der betroffenen Führungskräfte. Das BAG führt weiter aus, dass die Wahlberechtigung an die Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zum Betrieb anknüpfe. Diese wiederum werde durch die Eingliederung in die Betriebsorganisation begründet. Daraus lässt sich schließen, dass das BAG der Argumentation des LAG Baden-Württemberg nicht gefolgt ist, wonach sich der Eingliederungsbegriff des § 7 BetrVG vom Eingliederungsbegriff des § 99 BetrVG unterscheide.
Entscheidung an der Realität vorbei
Die Entscheidung zeigt, dass eine am Einzelfall orientierte Prüfung notwendig sein wird, welche Matrix-Führungskräfte in welche Betriebe eingegliedert sind und welche nicht. Denn die Zurückverweisung des BAG an das LAG verdeutlicht, dass es hier keine Pauschalaussagen geben kann, sondern stets der Einzelfall zu beleuchten ist.
Insgesamt wird aber durch diese BAG-Entscheidung erneut aufgezeigt, dass die Frage der richtig verorteten Mitbestimmung in der Matrix für die Praxis immer relevanter wird. Unternehmen mit Matrixstrukturen sind daher gut beraten, ihre gewachsenen Betriebsstrukturen mit ihrer tatsächlichen Arbeitsweise abzugleichen. Dabei kann es durchaus interessant sein, von den Möglichkeiten des § 3 BetrVG Gebrauch zu machen und Sparten- oder unternehmenseinheitliche Betriebsräte durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung zu bilden. Allerdings lehrt der aktuelle Fall, dass dies kein Allheilmittel ist. Das betroffene IT-Unternehmen hatte nämlich bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und dennoch Führungskräfte über die gewillkürten Betriebsgrenzen hinweg eingesetzt.
Für die Arbeitgeberseite ist die heutige Entscheidung misslich und geht an der betrieblichen Realität vorbei. Die Berücksichtigung der Belange der Führungskräfte, die sich von anderen Standorten aus virtuell zu ihrem Team zuschalten, dürfte nicht im Zentrum der Betriebsratsarbeit stehen. Dennoch dürfen diese künftig alle mitwählen – sofern sie im Einzelfall in den Betrieb eingegliedert sind. Es genügt dennoch im Lichte der heutigen BAG-Entscheidung nicht mehr, die Matrix-Führungskräfte ausschließlich ihrem Stammbetrieb zuzuordnen und dort auf die Wählerliste zu setzen. Interessant wird auch sein, ob das BAG in den Entscheidungsgründen Aussagen zu den Konsequenzen einer fehlerhaften Wählerliste (Nichtigkeit vs. Anfechtbarkeit der Betriebsratswahl) trifft.
Dr. Elena Heimann ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin bei Schweibert Lessmann. Sie ist spezialisiert auf betriebsverfassungsrechtliche Angelegenheiten sowie komplexe Restrukturierungsprojekte.