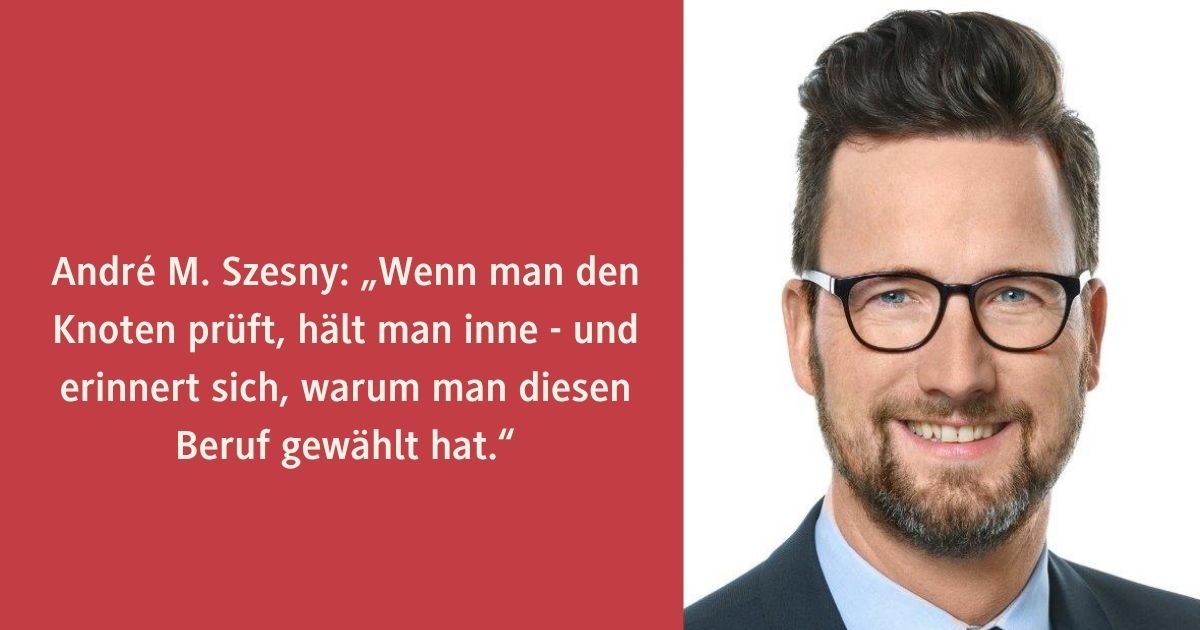Generell hat die Krawatte einen schweren Stand. Sie ist aus dem Alltag verschwunden wie das Faxgerät – nur mit deutlich mehr Stil. Doch der weiße Krawattenknoten – von manchem irritiert beäugt wie ein Relikt aus Opas Amtsgericht – lässt sich nicht unterkriegen. Obwohl keine ausdrückliche Regelung das Tragen einer weißen Krawatte (oder eines Pendants für Strafverteidigerinnen) vorschreibt: In der Strafverteidigung hält es sich hartnäckig, dieses kleine textile Symbol juristischer Würde. Nicht flächendeckend, aber völlig unabhängig von Berufserfahrung, Alter oder strafrechtlicher Spezialisierung.
Für manche steht die weiße Krawatte für mehr als nostalgisches Berufsethos. Sie steht für eine Idee: Dass der Strafverteidiger eben nicht einfach nur "Parteivertreter" ist, sondern ein Organ der Rechtspflege. Gleichauf mit Staatsanwalt und Gericht. Mit anderen Worten: Das weiße Stück Stoff soll nicht zieren, es soll markieren.
Doch was tun, wenn man keinen Knoten binden will, keinen Schlips tragen mag oder einfach keinen Hals dafür hat? Die Berufsordnung schweigt. Die Stilpolizei raunt. Und das Ergebnis? Während männliche Kollegen entweder pragmatisch im Bastelladen um die Ecke die Seidenkrawatte erwerben (freilich ohne sie dann zu bemalen) oder aber beim Maßschneider ihres Vertrauens die zwölffach gefaltete Seide bestellen, steht die Verteidigerin vor der Garderobenfrage des Jahrhunderts: Hemdbluse mit Stehkragen? Tuch mit Brosche? Oder gar keine textile Hervorhebung? Die weiße Krawatte ist ein Symbol, das mit dem biologischen Unterschied nicht rechnet.
Dem Staatsanwalt zu ähnlich?
Also lassen wir es doch am besten ganz sein. Weiße Krawatte? Wer braucht das noch? Schließlich ist der Strafverteidiger doch kein Museumsführer. Und: Mit der weißen Krawatte sieht man dem Staatsanwalt zum Verwechseln ähnlich – Camouflage der Hauptverhandlung: Flecktarn im Feld, Seidenweiß im Saal.
Nun ja, die Verwechslung lässt sich vermeiden, indem man sich mit der Sitzordnung im Strafprozess auseinandersetzt. Und ist es denn wirklich so schlimm, wenn sich Verteidiger und Staatsanwalt einander annähern – zumindest optisch? Besteht nicht ohnehin eine gemeinsame Grundlage?
Verteidigung und Staatsanwaltschaft sind Teil des Strafprozesses. Beide sind dem Recht und der Wahrheit verpflichtet – wenn auch auf unterschiedliche Weise. Beide stehen unter dem schlichten, aber gewichtigen Paradigma der Rechtspflege. Wer hier von zu viel Nähe spricht, scheint eine romantisierte Vorstellung vom Strafprozess zu haben: Hier der finstere Verteidiger mit schwarzem Humor und unlauteren Tricks, dort der weiße Ritter des Rechts und der Anklage. Ein Popanz, der genauerer Betrachtung nicht standhält – und heutzutage doch Grundlage mancher Medienberichterstattung über Wirtschaftsstrafverfahren zu sein scheint.
Natürlich: Verteidigerinnen und Verteidiger sind nicht neutral. Sie kämpfen für ihre Mandanten. Nur deren Interesse sind sie verpflichtet. Aber das bedeutet nicht, dass sie außerhalb der Strafprozessordnung agieren – ein gesetzlicher Rahmen, der zumindest versucht, das enorme Machtgefälle zwischen dem Staat auf der einen Seite und dem Beschuldigten auf der anderen zumindest ein Stück weit auszugleichen. Umgekehrt ist die Staatsanwaltschaft nicht das gute Gewissen der Republik. Auch sie handelt im Rahmen eines gesetzlichen Auftrags. Der Einwand, dass sich beide Seiten durch ein Stück Seide zu sehr ähneln könnten, beruht offenbar auf einem berufsrechtlichen und modischen Missverständnis.
Ausdruck eines Berufsverständnisses
Die weiße Krawatte ist kein Dresscode-Feuilleton, sondern eine Einladung zum Gespräch über die Rolle der Strafverteidigung. Wer sich dem weißen Tuch verweigert – aus modischen, politischen oder praktischen Gründen –, agiert nicht weniger berufsethisch als der weißbetuchte Traditionalist.
Wird sich die weiße Krawatte deshalb irgendwann verabschieden wie das Monokel oder das Florett? Möglich. Aber bis dahin bleibt sie – aus Stoff gemacht, doch voller Haltung. Für mich ist sie Symbol für die lange Tradition des Anwaltsberufs. Sie bringt Respekt gegenüber dem Gericht und der Staatsanwaltschaft zum Ausdruck. Sie hebt optisch von anderen Verfahrensbeteiligten ab und unterstreicht die besondere Rolle des Anwalts und der Anwältin als unabhängiges Organ der Rechtspflege. Sie ist Ausdruck eines Berufsverständnisses, das Respekt vor dem Gericht nicht als Unterwerfung, sondern als Selbstachtung begreift.
Und wenn es nur deshalb ist, weil man am Morgen der Hauptverhandlung wenigstens einmal kurz innehält, den Knoten prüft – und sich daran erinnert, warum man diesen Beruf gewählt hat. Übrigens: Mit zunehmender Zahl an Hauptverhandlungstagen klappt der Knoten immer besser.
Der Autor Dr. André M. Szesny ist Partner bei Heuking in Düsseldorf. Seine Schwerpunkte liegen im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, in Compliance & Internal Investigations.