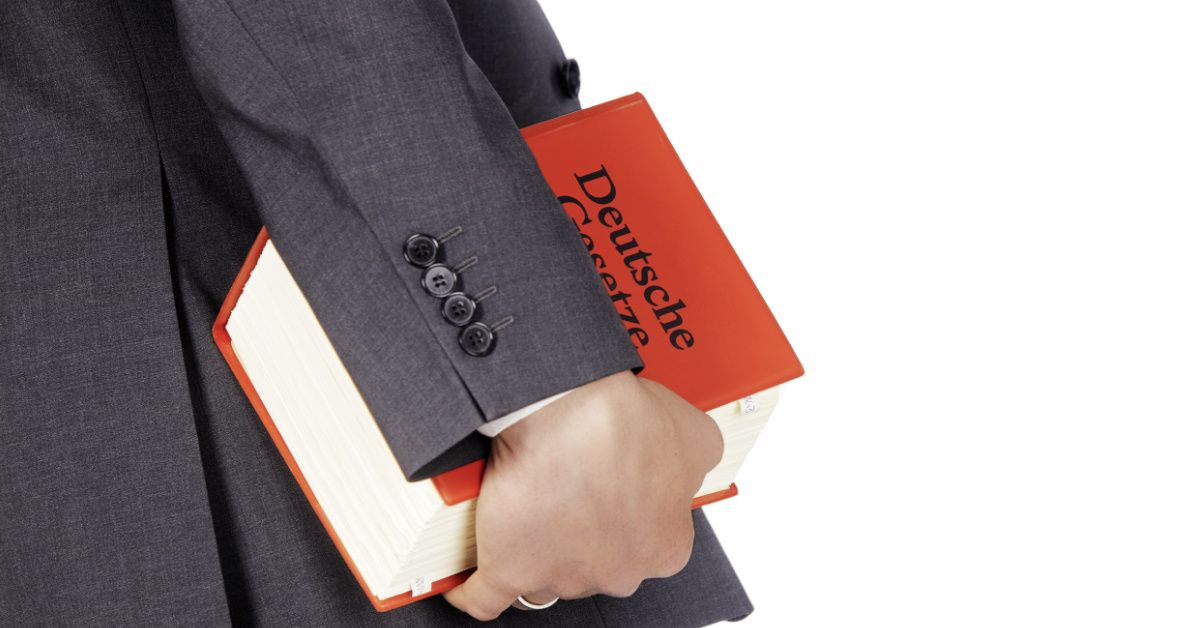Langwährende Diskussion
Die Diskussion über ein Unternehmensstrafrecht hat schon einen langen Bart. Aber erst seit der damalige Justizminister Nordrhein-Westfalens, Thomas Kutschaty (SPD), vor sieben Jahren einen ersten ausformulierten Gesetzentwurf vorlegte, steht es auf der rechtspolitischen Agenda beständig ganz weit oben. In dieser Legislaturperiode gehört es zu den wichtigsten Gesetzesvorhaben der Regierungskoalition. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet Kutschatys Nachfolger im Amt, Peter Biesenbach (CDU), gehört heute zu den ärgsten Widersachern des Unternehmensstrafrechts. Vergangene Woche schrieb er in einem Gastbeitrag für die FAZ von einem "Irrweg".
Kritik von allen Seiten
Mit seiner Kritik steht Biesenbach nicht allein. Auf den Referentenentwurf von April dieses Jahres erhielt das Bundesjustizministerium zahlreiche ablehnende Stellungnahmen. Dennoch beschloss das Kabinett kurze Zeit später einen Regierungsentwurf. Die Kritik riss seitdem nicht ab, wobei letztlich alle betroffenen juristischen Berufsgruppen mit dem Reformvorhaben nicht glücklich sind. Dass die Wirtschaft und mit ihr die Unternehmensjuristen opponieren, überrascht nicht. Die Anwälte stören sich neben anderen Aspekten vor allem an der Beschränkung der Beschlagnahmeverbote und an dem schlechten Bild vom Unternehmensverteidiger, das der Entwurf dabei zeichnet. Sogar die Staatsanwälte sehen den Entwurf kritisch: Wenn bei betriebsbezogenen Straftaten immer auch gegen das Unternehmen ermittelt werden müsse, binde das Personal und Kosten, heißt es aus den Strafverfolgungsbehörden. Außerdem sei man mit dem geltenden Recht der Verbandsgeldbuße bisher auch gut klargekommen.
Auflösung des Berufsgeheimnisses
Nach der Sommerpause geht der Gesetzentwurf ins parlamentarische Verfahren. Deshalb hat der Gegenwind jetzt nochmals massiv zugenommen. Die Präsidentin des DAV, Edith Kindermann, hat den rechtspolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen einen Brandbrief geschrieben, in dem es unter anderem heißt: "Der Regierungsentwurf löst einen Paradigmenwechsel an zwei Stellen aus, der rechtsstaatlich inakzeptabel und so für uns nicht hinnehmbar ist." Gemeint sind damit die "Auflösung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses" sowie "die Verabschiedung vom Schuldprinzip". Neben weiteren Kritikpunkten bemängelt die Verbandschefin, dass die Einwände aus den zahlreichen Stellungnahmen bisher ungehört verhallten. Sie appelliert daher an den Gesetzgeber, die Bedenken ernst zu nehmen.
Gegeninitiative im Bundesrat
Zudem haben sich sechs Bundesländer – Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein – gegen das Unternehmensstrafrecht verbündet. Sie legten gestern im Wirtschaftsausschuss des Bundesrats einen Antrag vor mit dem Ziel, das Vorhaben zu stoppen. Sie bezweifeln die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzesnovelle. Zudem sind ihnen die vorgesehenen Sanktionen zu hoch. Außerdem gibt es aus ihrer Sicht im geltenden Recht ausreichend Möglichkeiten, um Rechtsverstöße im Wirtschaftsleben zu ahnden. Der Antrag fand gestern im Ausschuss zwar keine Mehrheit. Zuvor hatte sich bereits der Rechtsausschuss des Bundesrats mit dem Gesetzentwurf befasst. Dessen ablehnender Beschluss soll Anfang nächster Woche veröffentlicht werden. Ob sich die Länderkammer aber letztlich gegen das Gesetzesvorhaben stellt, ist offen. Der Entwurf steht auf der Tagesordnung der Plenarsitzung am 18. September.