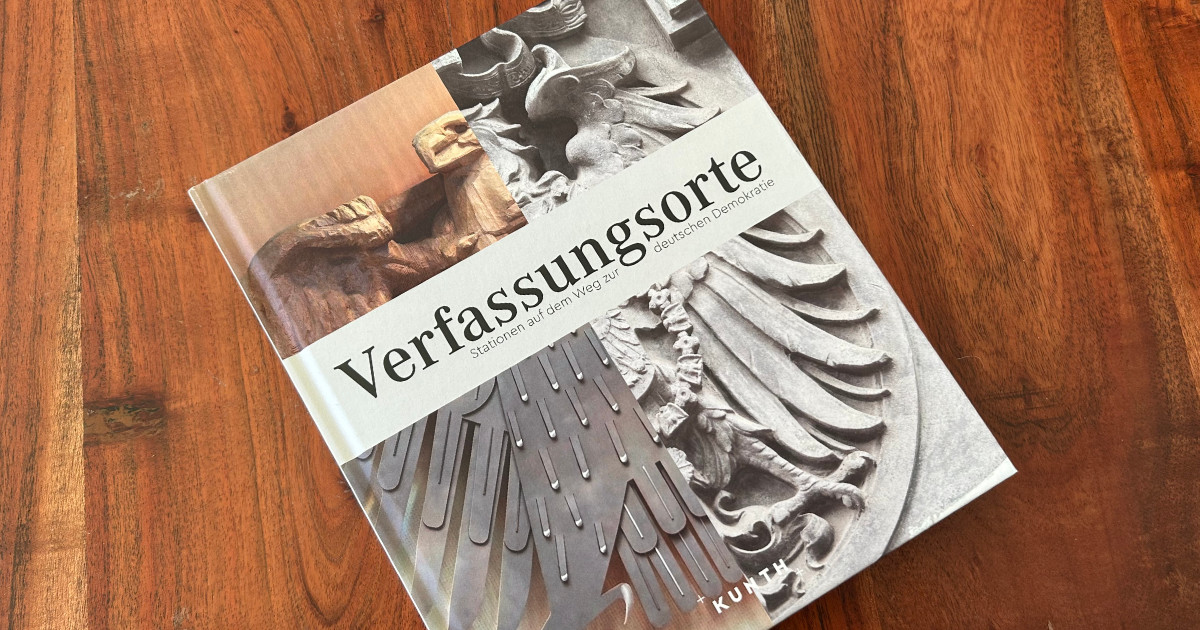Manche Verfassungsorte sind unscheinbar. Wie etwa ein kleiner Kiosk an der Ecke Heussallee/Platz der Vereinten Nationen in Bonn. Dort am "Bundesbüdchen" trafen sich Politiker, Journalistinnen, Bürgerinnen und Bürger der Bonner Republik regelmäßig, um ins Gespräch zu kommen. Bei einer Zeitung oder einem Kaffee sprachen sie über die Vorgänge im Bundestag, dem Bundesrat und dem Bundeskanzleramt, die sich allesamt in unmittelbarer Nähe befanden. Es wurde zum Symbol für die bodenständige Atmosphäre der Bonner Republik.
Manche Verfassungsorte hingegen sind bekannt, wie die Paulskirche, wo 1848 Vordenker die erste gesamtdeutsche Verfassung entwarfen – imposant, wie das alte Schloss Herrenchiemsee, wo der Geist des Grundgesetzes erstmals in Text gegossen wurde. Andere sind fort, aber unvergessen, wie das Residenzschloss Neustrelitz, das 1919 Geburtsstätte des ersten demokratischen Landesgrundgesetzes überhaupt war. Bis heute hat nur der Schlosskeller überdauert, doch: "Erst da wo die Schlösser verschwunden sind, da kann die demokratische Verfassung erblühen".
Verfassungskämpfe
Das sagt Markus Lang, ein Urheber des neu erschienenen Bildbandes Verfassungsorte – Stationen auf dem Weg zur deutschen Demokratie bei der Präsentation "seines" Buchs am Donnerstag in den Berliner Räumen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Was er meint, ist, dass Verfassungen – und von denen hatte Deutschland im Laufe der Geschichte einige – stets erkämpft werden mussten und bei weitem nicht immer demokratisch waren. Oft mussten Bürgerinnen und Bürger sie den Mächtigen – den Schlossbewohnern – entreißen, die Verfassungen bloß nutzen, um ihre eigene Macht zu zementieren. Sie mussten erstritten und verteidigt werden, gingen zugrunde und mussten wieder errichtet werden – bis heute.
Von diesen "Verfassungskämpfen" erzählt der Bildband. Dabei wäre es zu einfach, nur über das Grundgesetz zu sprechen, oder über die Weimarer Reichsverfassung. Denn Verfassungen gibt es in Deutschland seit mehr als 200 Jahren, und selbst davor ließen Schriften über politische Herrschaft bereits die Grundzüge von Verfassungen erkennen. Deshalb setzt das Buch im Jahr 1376 an, bei der Wahl der römisch-deutschen Könige und Kaiser im Kaiserdom St. Bartholomäus in Frankfurt.
Von dort aus arbeitet es sich unermüdlich vor, Bild für Bild, über das Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent von 1792 und die Erfurter Unionsverfassung von 1850 bis heute. Und: "Wer weiß, von welcher Republik die Berliner Republik einst abgelöst wird", sagt Lang. Die Idee ist einfach: Verfassungsgeschichte sichtbar und begehbar machen. "Man betritt das Mysterium der Verfassung." Das Buch sei eine Einladung, sagt Lang. "Besuchen Sie mit uns die Verfassungsorte".
Eine Reise durch die Republik
"Es wäre ja langweilig, wenn alle Verfassungsorte in Berlin lägen. Das Buch ist eine Reise durch die gesamte Bundesrepublik", sagt Lang. Diese begann interessanterweise mit der Idee eines Amerikaners: Russell Miller ist eigentlich Juraprofessor an der Washington and Lee University in Virginia, doch ein Stipendium führte ihn vor Jahren ans Bundesverfassungsgericht. Seither hat ihn deutsche Verfassungsgeschichte nicht losgelassen.
Die Idee, sie anhand ihrer Stätten zu erzählen, kam Miller 2018. Er sagt, der Holzadler im großen Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts habe ihn dazu inspiriert. Das Relief aus Pinienholz von Hans Kindermann habe ihn beruhigt. "Das Verfassungsrecht hat seine Flügel um uns gelegt. Es soll uns schützen."
Nach Jahren der Recherche, vielen privaten Reisen zu Verfassungsorten in Deutschland und einer pandemie-bedingten Pause fand Miller in der Stiftung Orte der Deutschen Demokratiegeschichte einen Partner für sein Projekt. Dort traf er Markus Lang und Kai-Michael Sprenger, die das Buch mit ihm verwirklichten. Die eigentlichen Stars der Geschichte – die Fotos – steuerte der Architekturfotograf Oleksander Telesnuik bei.
Das Projekt habe ihm deutlich gemacht, dass eine Verfassung nicht vom Himmel falle, sagt der Ukrainer bei der Präsentation. Die vielen Orte, die er habe besuchen dürfen, hätte ihm gezeigt, was es koste und wie lange es dauere, eine Demokratie aufzubauen. "Ich durfte diese Demokratie mit eigenen Händen anfassen", so Telesnuik. Manchmal musste er sich dabei an Baugerüsten und Werbebannern abarbeiten, an fremde Türen klopfen und auf Nachbarbalkone klettern. Für sein Lieblingsbild vom Kaiserdom in Frankfurt musste er wetterbedingt fünf Mal anreisen. Doch es habe sich gelohnt: Sieben Jahre, 4.500 Bilder und 140 Verfassungsorte später ist das Buch fertig.
Verfassungsentschlossenheit
"Demokratiegeschichte kann man nicht als Heldengeschichte erzählen", heißt es im Buch. "Die Verfassungsgeschichte Deutschlands ähnelt einem qualvollen und holprigen Prozess mit zahlreichen Rückschlägen." Die Paulskirchenverfassung, die nie das Licht der Welt erblickte, weil sich die revolutionäre Idee eines geeinten deutschen Staats noch nicht hatte durchsetzen können. Der grausame Zivilisationsbruch durch die Nazis, der nicht nur die Weimarer Reichsverfassung zerstörte, sondern mit ihr jede hart erkämpfte Errungenschaft auf dem Weg zu einem souveränen Volk, das Freiheit und Menschenrechte hochhält. Diese Misserfolge bezeugt auch der Bildband.
"Wir wollten auch die Ambivalenzen abbilden", sagen Lang und Sprenger. "Auch die ganz scharfen Brüche. Denn der Impuls – das 'Nie wieder' – ist dort entstanden." Ihre Bilder zeigten keine Orte perfekter Demokratien. Aber solche Orte sucht man wohl bis heute vergeblich. Sie sollten zeigen, wie man den Traum einer Verfassung, trotz massiver Rückschläge, am Leben halte.
Für Russell Miller ist das die "Verfassungsentschlossenheit" der Deutschen. Die Beharrlichkeit und das Engagement für eine Idee, die sie nicht aufgeben wollten. Etwas wehmütig spricht er darüber, welch großen Beitrag sein eigenes Land, die USA, nach dem zweiten Weltkrieg zur deutschen Demokratie beitragen konnte. Nun blicken die USA selbst der schärfsten Krise von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie seit Jahrzehnten ins Auge und könnten etwas von dieser "Verfassungsentschlossenheit" gebrauchen, wie Miller sagt.
Und er ist nicht der Einzige. Ex-Verfassungsrichter und Staatsrechtslehrer Dieter Grimm, der das Geleitwort zum Bildband verfasst hat, muss schlucken, als er über den Zustand von Demokratie und Verfassung in der Welt spricht. Mit Blick auf europäische Nachbarstaaten, auf Russland, die Türkei mahnt er, auch hierzulande die Errungenschaft der Verfassung zu schützen. Denn nur mit juristischer Geltung sei es nicht getan. Es seien die Bürgerinnen und Bürger, die eine Verfassung am Leben hielten. "Verfassung ist kein Schicksal", sagt Grimm, sie müsse auch heute erkämpft werden. "Das Buch kommt zum richtigen Zeitpunkt".
Verfassungsorte – Stationen auf dem Weg zur deutschen Demokratie ist im Kunth-Verlag erschienen und kostet 29,95 Euro.