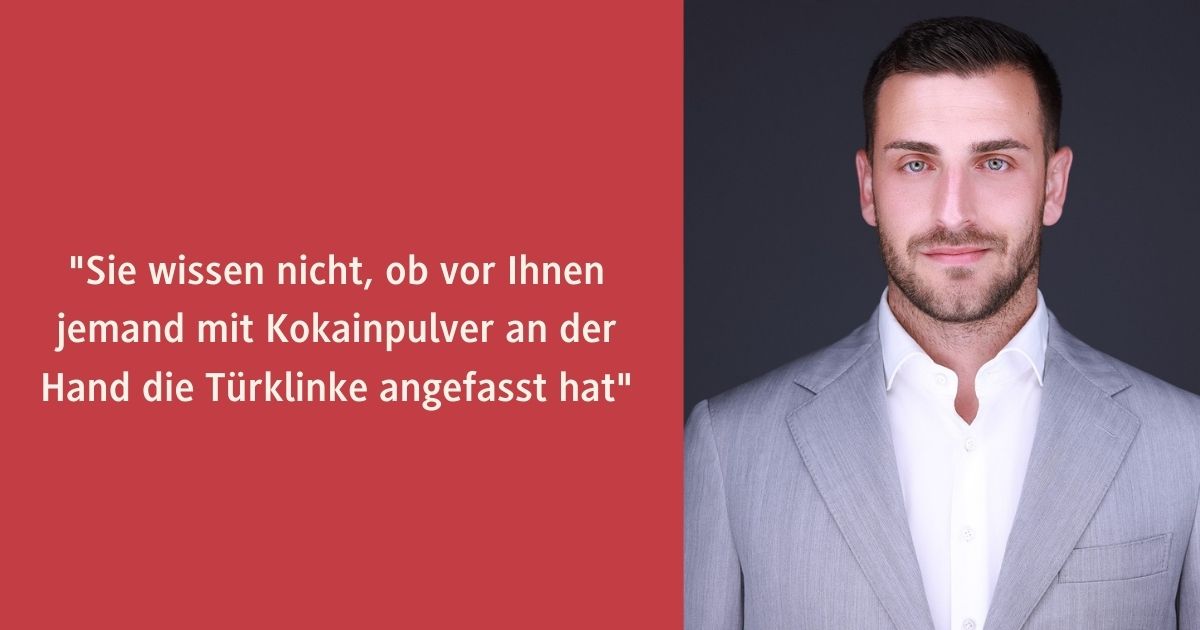beck-aktuell: Herr Dunjic, im März 2024 ist der Weltranglisten-Erste im Tennis, Jannik Sinner, positiv auf Clostebol getestet worden. Sinner behauptete, das Steroid sei unabsichtlich bei einer Massage in seinen Körper gelangt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) forderte zunächst eine Sperre von bis zu zwei Jahren, einigte sich dann aber mit Sinner überraschend auf eine nur dreimonatige Sperre. Pünktlich zum ATP Masters in Rom Anfang Mai darf er damit wieder antreten, was für viel Kritik gesorgt hat. Wie kam es zu dieser Einigung?
Dunjic: Die WADA hat offenbar zusammen mit Herrn Sinner ein sogenanntes Case Resolution Agreement geschlossen, eine Streitbeilegungsvereinbarung, die das Verfahren abschließt. Solche Einigungen sehen die Anti-Doping-Regularien vor.
beck-aktuell: Was genau ist die WADA eigentlich und was ist ihre Aufgabe?
Dunjic: Die WADA ist, wie Sie richtig sagten, die Welt-Anti-Doping-Agentur. Sie erlässt als weltweiter Regulator unter anderem den WADA-Code und viele weitere Regeln, die dann unter anderem von den Anti-Doping-Organisationen umgesetzt werden müssen, zum Beispiel von der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) in Deutschland.
"Ohne die WADA gibt es keinen Deal"
beck-aktuell: Wie läuft ein solches Doping-Verfahren grundsätzlich ab?
Dunjic: Eine sogenannte Ergebnismanagement-Organisation, bspw. die NADA, führt das Verfahren gegen eine Athletin oder einen Athleten. Dieses kann sie einstellen oder einen sogenannten Sanktionsbescheid erlassen. Falls die Athletin oder der Athlet einem Sanktionsbescheid nicht zustimmt, kommt es zu einem Disziplinarverfahren. Je nachdem kommt es dann noch zu einem Rechtsmittelverfahren, häufig beim internationalen Schiedsgericht im Lausanne, dem Court of Arbitration for Sport (CAS), und ggf. dann noch beim Schweizer Bundesgericht.
Die WADA hat auch die Möglichkeit, sich in ein solches Verfahren einzuschalten, das ist auch im Fall Sinner passiert. Dort wurde erstinstanzlich entschieden, Sinner treffe kein Verschulden. Die WADA hat dann Rechtsmittel eingelegt, womit es zum Verfahren vor dem CAS kam. Während dieses Verfahrens kam es dann zur erwähnten Streitbeilegung.
beck-aktuell: Muss sich denn die WADA einschalten, um das Verfahren vor die Sportgerichte zu bringen?
Dunjic: Nein, muss sie nicht. Darüber hinaus können je nachdem auch andere Organisationen, z.B. die nationale Anti-Doping-Agentur, Rechtsmittel zum CAS einlegen. Eine Einigung mit einer Athletin bzw. einem Athleten muss die WADA aber absegnen. Ohne sie gibt es keinen solchen Deal.
"Die WADA gibt die Regeln vor"
beck-aktuell: Wie sieht die Aufgabenverteilung zwischen der WADA und den Anti-Doping-Agenturen aus?
Dunjic: Die WADA gibt die Regeln vor und die Anti-Doping-Organisationen setzen sie um. Wer in welchem Verfahren zuständig ist, hängt aber sehr vom Einzelfall ab, etwa davon, in welchem Kontext, respektive wann und wo die Athletinnen und Athleten getestet wurden. Bei Jannik Sinner war es zum Beispiel die International Tennis Integrity Agency (ITIA), die im Auftrag der International Tennis Federation (ITF) für das Ergebnismanagement zuständig war, den erstinstanzlichen Entscheid fällte dann – entsprechend einer reglementarisch vorgesehenen "Auslagerung" – ein unabhängiges Gremium außerhalb der ITIA/ITF.
beck-aktuell: Legt die WADA auch fest, welche Substanzen verboten sind, bzw. was für ein Strafkatalog gilt?
Dunjic: Ja, sie gibt auch die "Prohibited List" vor, eine Verbotsliste, die dann von den anderen Anti-Doping-Organisationen angewendet wird. Auch der Strafrahmen wird von der WADA vorgegeben. Stakeholder wie die nationalen Anti-Doping-Agenturen können sich aber in die Entwicklung der Regularien einbringen.
"Athletinnen und Athleten müssen geschult werden"
beck-aktuell: Offenbar fungiert die WADA in dem Prozess nicht als eine neutrale Instanz, sondern eher eine Art zweite Anklagebehörde. Wer trifft in diesem ganzen Verfahren die finale Entscheidung darüber, ob ein Doping-Verstoß vorliegt?
Dunjic: Das hängt vom Einzelfall ab. Wenn bei einem deutschen Athleten von der NADA ein Doping-Verstoß festgestellt wird und dieser damit nicht einverstanden ist, entscheidet häufig – je nach anwendbarem Reglement, respektive anwendbarer Vereinbarung – erstinstanzlich das Deutsche Sportschiedsgericht (DIS). Dann gibt es wiederum eine Liste von Personen und Organisationen, die diesen Entscheid anfechten können, häufig – wiederum sofern entsprechend in den Regularien vorgesehen oder entsprechenden vereinbart – beim CAS. Dort gibt es ein neues Verfahren und ein neues Urteil. Hiergegen gibt es theoretisch auch noch die Möglichkeit, vor das schweizerische Bundesgericht zu ziehen. Allerdings ist das, was man dort vorbringen kann, beschränkt. Wer also schlussendlich final entscheidet, hängt sehr vom Einzelfall ab.
beck-aktuell: Das klingt kompliziert: Unterschiedliche Zuständigkeiten je nach Wettbewerb, Verfahren werden ausgelagert, verschiedenste Organisationen haben ein Mitspracherecht. Dabei geht es für die Sportlerinnen und Sportler im Zweifel um ihre Karriere. Ist ein solches Dickicht an Zuständigkeiten nicht problematisch?
Dunjic: Man muss das aus zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite ist der Kampf für einen sauberen Sport sehr wichtig. Und dafür braucht es auch Regeln und Mechanismen. Auf der anderen Seite verfügen die meisten Athletinnen und Athleten über keine juristische Ausbildung. Es ist nicht ganz einfach, all diese Regeln zu durchblicken. Daher ist es wichtig, sie regelmäßig zu schulen: Was sind Anti-Doping-Regeln? Was darf man, was darf man nicht? Wie könnte man "kontaminiert" werden? Es gibt sehr viele Fragen und es ist immens wichtig, unter anderem zu verstehen, wie so ein Verfahren abläuft.
"Sie wissen nicht, ob vor Ihnen jemand mit Kokainpulver an der Hand die Türklinke angefasst hat"
beck-aktuell: Ein weiteres Problem hat uns in Deutschland der Fall der Eisschnellläuferin Claudia Pechstein vor Augen geführt: Sportlerinnen und Sportler unterwerfen sich dem Reglement der WADA und der Jurisdiktion von DIS und CAS und geben ihr Schicksal somit in die Hände nichtstaatlicher Akteure. Allerdings geschieht das nicht aus freien Stücken, da sie eine Profi-Karriere nur innerhalb dieser Verbände und ihrer Vorschriften betreiben können. Sehen Sie diese Machtposition kritisch?
Dunjic: Die Athletinnen und Athleten haben im Prinzip keine andere Wahl, als sich diesen Regelwerken zu unterwerfen, wenn sie im organisierten Sport tätig sein wollen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage: Wie würde der organisierte Sport ohne einheitliche Regeln aussehen?
beck-aktuell: Im Fall Sinner wittern einige Mauschelei zwischen Sportler und der WADA. Vor den Olympischen Spielen 2021 deckte ein ARD-Bericht auf, dass die WADA einen mutmaßlichen Doping-Fall im chinesischen Schwimmer-Team nicht weiterverfolgt hatte. Teilen Sie die Sorge, dass solche Vorfälle die Legitimation der WADA untergraben?
Dunjic: Dazu möchte ich mir kein Urteil anmaßen und auch niemandem etwas unterstellen. Fakt ist, dass die Labore immer besser werden. Man findet heute bereits kleinste Mengen verbotener Substanzen, die auf ganz unterschiedliche Art in den Körper gelangen können, etwa durch den Konsum von Fleisch, das aus Ländern stammt, in welchen von der WADA verbotene Substanzen legal in der Zucht verwendet werden. Oder bei Substanzen, die in der Gesellschaft weit verbreitet sind, wie zum Beispiel Kokain. Sie wissen beispielsweise nicht, ob vor Ihnen jemand mit Kokainpulver an der Hand eine Türklinke angefasst hat. Wenn Sie diese dann anfassen, könnten Sie je nachdem anschließend positiv sein.
"Athletinnen und Athleten müssen ihre Unschuld beweisen"
beck-aktuell: Wie komme ich als Sportlerin oder Sportler denn gegen die Vermutung an, dass ich gedopt hätte?
Dunjic: Nach dem sogenannten Strict Liability-Prinzip müssen Athletinnen und Athleten, wenn sie positiv getestet werden, beweisen, dass sie die Substanz weder absichtlich genommen haben noch sie irgendein Verschulden trifft. Das kann sehr kompliziert sein.
beck-aktuell: Wie geht man das konkret an?
Dunjic: Das kommt sehr auf den Einzelfall an und hängt beispielsweise von der betroffenen verbotenen Substanz ab. Man versucht üblicherweise zu ermitteln, wie diese Substanz in den Körper gekommen ist. Beispielsweise klärt man – ausgehend vom Zeitpunkt des fraglichen Tests – ab, wie lange diese Substanz überhaupt nachweisbar ist, und bestimmt ein Zeitfenster, in dem sie in den Körper gelangt sein muss. Hat man in diesem Zeitfenster beispielsweise ein Medikament genommen, könnte man das in die Analyse geben, um zu schauen, ob es vielleicht kontaminiert war. Was man konkret macht, ist sehr individuell, aber es ist in der Regel sehr aufwändig, zeitlich wie auch finanziell.
"Wer mehr finanzielle Mittel hat, kann sich auch besser verteidigen"
beck-aktuell: Wie groß ist das finanzielle Problem dabei für betroffene Sportlerinnen und Sportler?
Dunjic: Die finanzielle Belastung ist für die Athletinnen und Athleten in der Regel enorm. Deutschland hat es insofern relativ gut gelöst, als dass man beim DIS schon eine Verfahrenskostenhilfe bekommen kann. Das ist aber nicht überall so. Beim CAS bspw. kostet ein Verfahren häufig viele Tausend Schweizer Franken. Das ist schon ohne Kosten für Rechtsberatung und Sachverständigengutachten ein enormer Betrag, den eine Athletin respektive ein Athlet da stemmen muss.
beck-aktuell: Am Fall von Jannik Sinner hat sich auch deshalb Kritik entzündet, weil die Vermutung im Raum stand, die WADA wolle hier der vielversprechenden Karriere des gerade einmal 23-jährigen Weltranglisten-Ersten nicht im Weg stehen. Der Eindruck war: Die WADA hängt die Kleinen und lässt die Großen laufen. Können Sie das nachvollziehen?
Dunjic: Das möchte ich nicht beurteilen und auch niemandem etwas unterstellen. Was ich aber sagen kann, ist, dass, wer mehr finanzielle Mittel hat, sich üblicherweise auch besser verteidigen kann. Je mehr finanzielle Ressourcen man hat, desto eher wird man bspw. die entsprechenden Analysen vornehmen, um vielleicht einen Beweis für die eigene Unschuld zu finden.
Letztlich läuft es bei einem Doping-Vorwurf so: Wenn man sich nicht verteidigt, dann erhält man normalerweise die Regelsperre, bei einem positiven Test je nach Substanz zum Beispiel vier Jahre. Wenn man sich (umfassend) verteidigt, kann es zwar sein, dass man immer noch die vier Jahre kriegt. Es kann aber auch sein, dass man dann zum Beispiel mit einer Haaranalyse und weiteren Indizien darlegen kann, dass der Anti-Doping-Verstoß nicht absichtlich und nicht signifikant verschuldet war, was keine oder eine ggf. stark reduzierte Sperre zur Folge hätte.
beck-aktuell: Herr Dunjic, vielen Dank!
Ivan Dunjic ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei epartners Rechtsanwälte in Zürich. Er ist insbesondere auf (wirtschafts-)strafrechtliche und sportbezogene Angelegenheiten spezialisiert, berät u. a. im internationalen Sportrecht.
Die Fragen stellte Maximilian Amos.