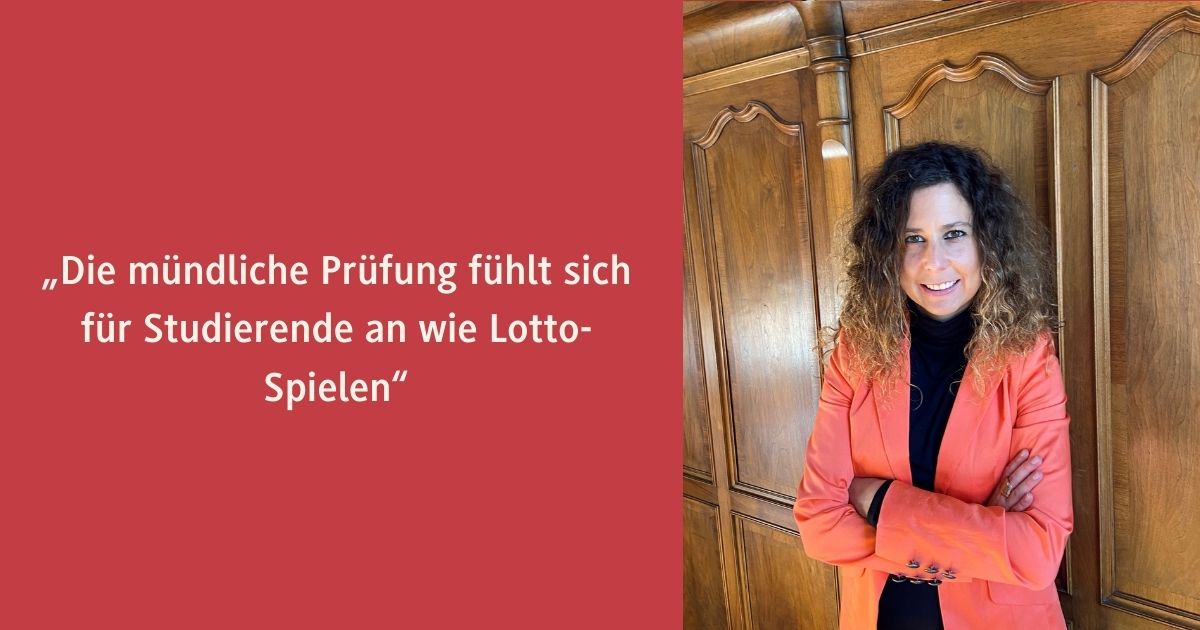beck-aktuell: Frau Dr. Hamed, Sie haben in Ihrer Dissertation zur psychischen Verfasstheit von Examenskandidatinnen und -kandidaten geforscht. Wie geht es denn unseren Studierenden?
Hamed: Anekdotisch war uns das allen wohl schon bewusst, aber es hat sich bestätigt, dass die Examensvorbereitung eine psychisch sehr belastende Zeit ist. Wenngleich ich in meiner Studie keine Kausalität nachgewiesen habe, ist es doch plausibel, dass die psychischen Belastungen, die ich messen konnte, im Wesentlichen auf das Examen zurückzuführen sind.
beck-aktuell: Wie genau lässt sich der Stress denn messen?
Hamed: Ich habe standardisierte Fragebögen genutzt, die auch von psychotherapeutischen Beratungsstellen eingesetzt werden, um klinisch relevante Auffälligkeiten, wie z. B. depressive Symptome, zu erkennen. Dabei habe ich festgestellt, dass es sehr hohe Werte beim Thema Depressivität gab. Bei knapp 40% der Examenskandidatinnen und -kandidaten waren zudem die Prüfungsangstwerte erhöht. Signifikant erhöhte Werte waren außerdem bei der allgemeinen psychischen Belastung zu beobachten. Alle Werte lagen deutlich über dem Schnitt in der Bevölkerung.
"Risiko, dass der Stress chronifiziert"
beck-aktuell: Nun sind Prüfungsangst und Stress im Studium erst einmal nichts, was nur Juristinnen und Juristen kennen…
Hamed: Nein. Das Besondere ist hier, dass diese Phase sehr lange dauert. Durchschnittlich ca. eineinhalb Jahre befinden sich die Studierenden in der Stresssituation "Examensvorbereitung". Wenn man dann noch das zweite Examen dazu nimmt, das ich nicht untersucht habe, kommt man sogar auf rund drei Jahre Belastungszeit. Das birgt auch Risiken dafür, dass sich der Stress chronifiziert.
beck-aktuell: Sie haben sich auch damit beschäftigt, woher die Belastung kommt und was man dagegen tun könnte. Was haben Sie da herausgefunden?
Hamed: Es spricht einiges dafür, dass ein Faktor die sogenannte Kontrollüberzeugung ist. Das bedeutet so viel wie: Gehe ich davon aus, dass mein Verhalten Einfluss auf ein Ergebnis hat? Eine internale Kontrollüberzeugung wäre – vereinfacht ausgedrückt: Wenn ich lerne, bekomme ich eine gute Note.
In meiner Studie habe ich Zusammenhänge zwischen der Kontrollüberzeugung und psychischen Belastungen beobachtet: Wenn ich davon ausgehe, dass ich meine Note nicht oder nur wenig beeinflussen kann, sind die psychischen Belastungen auch höher. Es könnte also sinnvoll sein, die internale Kontrollüberzeugung der Studierenden zu erhöhen.
"Studierende sind nicht faul"
beck-aktuell: Aber es könnte doch auch sein, dass jemand nicht fähig genug ist und deswegen nicht abschätzen kann, ob er oder sie eine bestimmte Note verdient hätte?
Hamed: Natürlich gibt es auch Studierende, die nicht in der Lage sind, das Staatsexamen zu bestehen oder ihre Leistung korrekt zu bewerten. Aber vor dem Ablegen des Pflichtteilexamens greift ein gewisser Filter. Ich habe diejenigen untersucht, die sich zum Befragungszeitpunkt bereits in der Vorbereitung auf das Pflichtteilsexamen befanden, also insbesondere die Zwischenprüfung absolviert haben. Ich habe u.a. abgefragt, wie die Leistungserwartungen sind, die die Studierenden an sich legen und auch, wie hoch ihre Leistungsbereitschaft ist. Es hat sich gezeigt, dass es eine sehr hohe Leistungsbereitschaft gibt, über 50% der Studierenden lernen an sechs bis sieben Tagen pro Woche, mehrheitlich 41 Stunden/Woche und mehr. Sie sind also nicht "faul".
Interessant ist aber, dass über 60% neun Punkte und mehr im Pflichtteilexamen als Ziel zu Beginn ihrer Examensvorbereitung angaben. Die Realität ist, dass es deutlich unter 20% sind, die im ersten Versuch ein solches Prädikatsexamen, also neun Punkte aufwärts, schaffen. Das heißt, die Leistungserwartungen der Studierenden sind statistisch gesehen überzogen. In der Folge kommt es vermehrt zu frustrierenden Lernerlebnissen, was die psychische Belastung zusätzlich erhöhen kann.
beck-aktuell: Gleichwohl kann die Lösung nicht sein, dass jede und jeder neun Punkte bekommt, wenn man es nur möchte.
Hamed: Selbstverständlich nicht. Die Frage ist eher: Warum wollen denn die Studierenden neun Punkte und mehr? Fakt ist: Die Bedeutung der Note wird erheblich überschätzt. Der Arbeitsmarkt für Juristen und Juristinnen ist gerade sehr gut, weshalb man für viele Bereiche nicht mehr – wie früher – zwei Prädikatsexamina braucht. Ich glaube, dass man als Lehrende auch ein realistisches Bild des Arbeitsmarktes vermitteln sollte, dass es gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt gibt, und zwar auch ohne Prädikatsexamen.
"Man will zur kleinen Elite gehören"
beck-aktuell: Ein beliebtes Argument gegen Reformvorhaben in der juristischen Ausbildung ist, dass diese auch mental auf einen später oft sehr stressigen Arbeitsalltag vorbereiten soll. Ist da etwas dran?
Hamed: Vielleicht müssen wir auch ein wenig größer denken: Vielleicht ist es nicht richtig, dass wir beispielsweise in der Justiz völlig "abgesoffene" Dezernate haben und die Richter und Richterinnen gar nicht mehr hinterherkommen, was natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität ihrer Arbeit hat. Man könnte also auch überlegen, das System als solches zu hinterfragen: Was ist das Bild, das wir von einem Juristen oder einer Juristin haben? Was sollen sie eigentlich können?
Schon während meines Studiums hat es mich frustriert, dass Kommilitoninnen und Kommilitonen, wenn ich etwa ein spannendes Urteil mit ihnen diskutieren wollte, oft als erstes gefragt haben: "Ist das examensrelevant?" Man sollte sich also mal Gedanken machen, ob es ein gedeihliches Klima für die Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn junge Menschen so unter Druck gesetzt werden und dieser dann auch im Berufsleben wie selbstverständlich fortgeführt wird.
beck-aktuell: Sie haben in ihrer Studie auch nach Reformwünschen gefragt, was allerdings nicht auf besonders fruchtbaren Boden gefallen ist. Woran liegt es, dass die Studierenden sich nicht stärker für Veränderungen in der Ausbildung einsetzen?
Hamed: In der Tat ist es so, dass die Studierenden wohl mehrheitlich am bestehenden System festhalten wollen. Vielleicht bedeutet das, dass sie im Großen und Ganzen mit dem System zufrieden sind. Es könnte aber auch daran liegen, dass sie bereits kurz vor dem Examen stehen, und damit schon recht weit im System vorgerückt sind. Auch die Fachkultur könnte mit reinspielen. Jurastudierende zeichnen sich sehr stark durch ihre hohe Leistungsbereitschaft aus und natürlich ist es eine Art Belohnung, wenn man selbst am Ende mit zwei Prädikatsexamina dasteht und damit zu einer kleinen Elite gehört. Diese Elitenbildung könnte zudem ein Grund für die starke Beharrungstendenz sein. Die Gründe für die Angaben habe ich allerdings nicht abgefragt, das sind also nur mögliche Interpretationen.
"Die mündliche Prüfung fühlt sich für Studierende an wie Lotto-Spielen"
beck-aktuell: Kommen wir noch einmal zurück zur Frage, was man gegen den Druck und die hohen Depressionswerte im Studium tun kann. Was müsste noch passieren?
Hamed: Mit meiner Dissertation wollte ich vor allem eine empirische Grundlage für eine weitere Reformdiskussion liefern, damit diese evidenzbasiert geführt werden kann. Bislang dreht sich da sehr viel um Meinungen. Aufgrund des hohen psychischen Drucks und der Gefahren, die daraus resultieren, empfiehlt es sich aber meiner Ansicht nach, die Belastung im Examen zu reduzieren. Meine Empfehlung wäre daher zum einen, den Prüfungsstoff zu reduzieren. Eine Möglichkeit ist es auch, die Prüfungsleistungen abzuschichten. Mittlerweile haben ja immerhin einige Bundesländer und Universitäten den integrierten Bachelor im Jurastudium eingeführt. Auch das Einbeziehen von Studienleistungen in die Examensnote sollte vor diesem Hintergrund diskutiert werden.
Darüber hinaus sollte man versuchen – Stichwort: Kontrollüberzeugung –, das Vertrauen in die Validität der Prüfungen zu erhöhen. Es scheint wenig Vertrauen in die objektive Nachvollziehbarkeit der Korrekturen zu geben und auch die mündliche Prüfung fühlt sich für die Studierenden wohl – überspitzt formuliert – ein bisschen wie Lotto-Spielen an. Das ist natürlich fatal.
beck-aktuell: Wie ließe sich dem entgegenwirken?
Hamed: Vor allem, indem man Transparenz in der Leistungsbewertung schafft. Das geht etwa, indem man Prüfungsbewertungen, soweit es geht, objektiviert, z. B. mit Rohpunkteskalen oder Multiple-Choice-Klausuren. Dazu gehört aber auch ein funktionierendes Korrekturmanagement, nicht nur im Examen, sondern schon an der Universität. Ziel muss es sein, dass die Jurastudierenden, wenngleich sie mit der Note natürlich nicht einverstanden sein müssen, diese zumindest nachvollziehen können.
beck-aktuell: Frau Dr. Hamed, haben Sie vielen Dank für das Gespräch!
Dr. Jessica Hamed ist Fachanwältin für Strafrecht in Wiesbaden und stellv. Direktorin des Instituts für Weltanschauungsrecht. Sie lehrt zudem an der Hochschule Mainz. Ihre Dissertation ist im Mai erschienen und trägt den Titel "Psychische Belastungen in der Vorbereitung auf das erste juristische Staatsexamen" (Nomos, 1. Auflage 2025). Sie beschäftigt sie sich mit der Reformbedürftigkeit der juristischen Ausbildung unter Berücksichtigung der Belastungen, die mit der Examensvorbereitung einhergehen.
Die Fragen stellte Dr. Hendrik Wieduwilt.
Das ganze Gespräch hören Sie in der aktuellen Folge 51 von Gerechtigkeit & Loseblatt – Die Woche im Recht, dem Podcast von NJW und beck-aktuell.