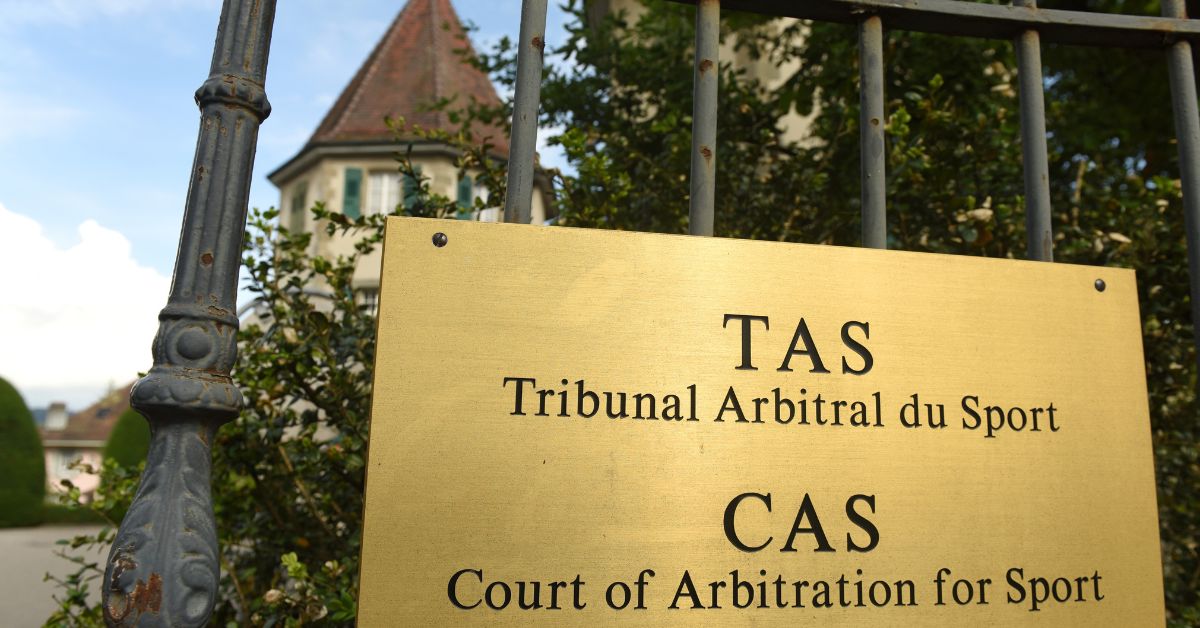Im Weltsport ist der Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne seit Jahrzehnten die oberste Instanz für sportrechtliche Streitigkeiten. Schnelligkeit, Fachnähe und internationale Anerkennung sprechen für ihn. Spätestens seit dem Urteil des EuGH vom vergangenen Freitag (Urteil vom 01.08.2025 – C-600/23) steht die Struktur des CAS jedoch unter gewaltigem Druck.
Nationale Gerichte der EU dürften sich nicht durch Schiedssprüche aus Lausanne daran hindern lassen, die grundlegenden Vorgaben des Unionsrechts durchzusetzen, stellte der Gerichtshof darin klar. Damit wird der anhaltenden Diskussion über die Legitimität der bestehenden Sportschiedsgerichtsbarkeit ein neues Kapitel hinzugefügt, ohne dogmatisch große Neuerungen zu bieten.
Streit um Rechte an Fußballspielern
Auslöser des Streits war eine Vertragskonstruktion, die lange im Profifußball verbreitet war: das sogenannte "Third Party Ownership" (TPO). Dabei werden wirtschaftliche Rechte an Spielern, vor allem Anteile an künftigen Transfererlösen, an externe Investorinnen und Investoren verkauft. Der belgische Fußballklub Royal Seraing hatte ein solches Modell genutzt und dabei mit der Investmentfirma Doyen Sports kooperiert. Die FIFA verbot im Jahr 2015 jedoch solche Konstruktionen und belegte den Klub mit Transfersperren und Geldstrafen.
Royal Seraing bestritt zunächst den sportrechtlich üblichen Rechtsweg, der nach verbandsinterner Klärung zum CAS und anschließend zum Schweizer Bundesgericht führte, blieb jedoch vor all diesen Spruchkörpern erfolglos. Der Verein wandte sich daraufhin an belgische Gerichte, um die Vereinbarkeit der FIFA-Regeln mit dem Unionsrecht prüfen zu lassen. Die ersten Instanzen bestätigten den CAS-Schiedsspruch noch als endgültig und rechtskräftig. Der Kassationshof, das oberste belgische Zivilgericht, hatte jedoch Zweifel und legte dem EuGH die Frage vor, ob nationale Gerichte nicht die Möglichkeit haben müssen, Schiedssprüche aus Drittstaaten, die nur von Gerichten ohne Vorlagemöglichkeit an den EuGH überprüft wurden, inhaltlich auf ihre Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu überprüfen.
Eindringliche Erinnerung aus Luxemburg: CAS hat keine strukturelle Immunität
Dies bejahte nun der EuGH, der klarstellte, dass Schiedssprüche des CAS nicht letztgültig sind, sondern in der EU der Kontrolle staatlicher Gerichte unterliegen. Diese Feststellung traf er allerdings mit größerer Zurückhaltung, als es noch die Generalanwältin Capeta vorgeschlagen hatte. Sie hatte gefordert, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten CAS-Entscheidungen weitgehend neu aufrollen und die gesamte Breite des EU-Rechts als Maßstab heranziehen können müssten. So weit wollte der Gerichtshof nun nicht gehen, sondern führte lediglich bestehende Linien seiner Rechtsprechung pointiert fort. Schiedsgerichte sind danach legitim, selbst dann, wenn sich Sportlerinnen und Sportler ihnen nicht freiwillig unterwerfen, sondern dies von ihren Verbänden vorgeschrieben bekommen. Auch die Tatsachen, die ein Schiedsgericht seiner Entscheidung zugrunde legt, werden wohl regelmäßig nicht vor nationalen Gerichten neu erhoben werden können. Maßstab der Überprüfung durch staatliche Gerichte ist auch nicht das gesamte EU-Recht, sondern lediglich die öffentliche Ordnung (ordre public) der Europäischen Union.
Dies alles ist im Kern nicht neu, sondern hält sich an die Terminologie, die Art. V Abs. 2 b) des New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche und hierzulande § 1059 Abs. 2 S. 2 b) ZPO vorsehen. Wenig überraschend ist auch, dass der Gerichtshof als Mindestbestandteile des ordre public das primärrechtlich verankerte Wettbewerbsrecht (Art. 101, 102 AEUV) und die Grundfreiheiten des Binnenmarktes (Art. 26 Abs. 2 AEUV) nennt. Um diese Vorgaben durchzusetzen, müssen auch einstweilige Anordnungen und Vorlagen an den EuGH möglich sein. Die Kernbotschaft besteht also in einer eindringlichen Erinnerung: Das Interesse an einer international einheitlichen und effektiven Sportgerichtsbarkeit rechtfertigt keine strukturelle Immunität gegenüber staatlicher Kontrolle und keine Umgehung zentraler Grundsätze des Unionsrechts, deren Reichweite einzig und allein der EuGH bestimmt.
Darauf hätte das oberste belgische Gericht auch ohne Vorlage kommen können, und in Luxemburg hätte es auch keine Befassung der Großen Kammer gebraucht. Dass der Ablauf dennoch so war und der Gerichtshof sogar ein Erklärvideo zur Entscheidung mit einer Einordnung des zuständigen Berichterstatters Jan Passer erstellen ließ, zeugt jedoch von einem ausgeprägten Sendungsbewusstsein. Offensichtlich herrscht Unzufriedenheit damit, wie der CAS, das Schweizer Bundesgericht und die Gerichte der EU-Mitgliedstaaten die bekannten Vorgaben handhaben.
CAS-Struktur im Fokus von EuGH und EGMR
Dementsprechend rückten im Urteil die strukturelle Unabhängigkeit und die effektive Kontrolle des CAS in den Fokus. Schon im Nachgang zum EuGH-Urteil über die Verbands-Regeln der International Skating Union (ISU) im Dezember 2023 wurde diskutiert, ob bei EU-relevanten Fällen eine institutionelle Entflechtung oder eine regionale Schiedsinfrastruktur notwendig sei. Inzwischen nehmen einzelne Fachverbände bei Sachverhalten mit Unionsbezug bereits darauf Rücksicht. Insbesondere führte der europäische Fußballverband UEFA letztes Jahr – zunächst beschränkt auf Streitigkeiten im Hinblick auf ihre Genehmigungsregeln für internationale Klubwettbewerbe – die Möglichkeit ein, das Verfahren nach Wahl des Schiedsklägers vor einem alternativen Sitz des CAS in Dublin durchzuführen, wo für die staatliche Überprüfung der irische High Court zuständig ist, der – anders als in der Schweiz – direkt Vorlagefragen an den EuGH weiterreichen kann.
Rechtlicher Druck kommt aber nicht nur aus Luxemburg. Wenige Wochen vor dem EuGH hatte der EGMR im Fall der intergeschlechtlichen Olympiasiegerin Caster Semenya geurteilt, dass das Verfahren vor dem CAS und dessen Überprüfung durch das Schweizer Bundesgericht nicht den Anforderungen an ein faires Verfahren genügten. Auch hier ging es um die einseitig vorgegebene Struktur und die zu großzügigen Maßstäbe bei der Kontrolle, allerdings unter dem Blickwinkel des europäischen Menschenrechtsschutzes (Art. 6 EMRK, Recht auf ein faires Verfahren). Das Straßburger Urteil spricht mithin eine andere Sprache, folgt aber derselben Logik: Wer dem CAS unterliegt, kann dennoch die Einhaltung des Kernbestands europäischer Rechtsstandards beanspruchen.
Kommt eine Rechtszersplitterung im Weltsport?
Kurzfristig steht der CAS nun vor der Aufgabe, seine Verfahren EMRK-konform und seine materiellen Maßstäbe bei EU-Bezug auch unionsrechtskonform auszugestalten. Dies wird jedoch absehbar nicht dazu führen, dass es eine Art "Brüssel-Effekt" auf den Weltsport gibt, wonach internationale Verflechtungen dafür sorgen, dass Regeln großer Märkte wie der EU auch anderenorts übernommen werden – auch wenn das Sendungsbewusstsein des EuGH erkennbar (auch) darauf zielt. Die kurzfristige Lösung könnte vielmehr darin liegen, nach dem Vorbild der Dublin-Lösung bspw. einen ausschließlich für die EU zuständigen ständigen CAS-Ableger zu errichten. Dies würde wahrscheinlich auch eine stärkere Trennung zwischen dem strikt wettkampfbezogenen sportgerichtlichen Kerngeschäft und der Überprüfung wirtschaftlicher Vorgaben der Sportverbände nach sich ziehen. Nicht auszuschließen ist dann jedoch eine Gegenbewegung, die einen weiteren alternativen CAS-Sitz ganz außerhalb Europas, also auch außerhalb des Anwendungsbereichs der EMRK, ins Spiel bringt. Um eine Zersplitterung des internationalen Sportrechts zu vermeiden, werden die Sportverbände und der CAS voraussichtlich auch jetzt bestrebt sein, nur minimalinvasive Konsequenzen aus der neuesten Rechtsprechung zu ziehen.
Das EuGH-Urteil in der Rechtssache Royal Seraing ist somit für die Entwicklung der Rechtsdogmatik von überschaubarer Bedeutung. Wichtiger ist, wie unzufrieden der Gerichtshof mit der zurückhaltenden Anwendung unionsrechtlicher Maßstäbe im Sportrecht sowohl auf Seiten der Verbände und des CAS als auch auf Seiten der mitgliedstaatlichen Gerichte ist. Die Sportverbände dürfen weniger denn je auf die Autonomie ihres Schiedsgerichtssystems hoffen, wenn sie subjektive Rechte aus dem Binnenmarktrecht, dem wirtschaftlichen Kernstück des EU-Rechts, beeinträchtigen. Eine Sitzaufspaltung des CAS ist damit kein bloßes Gedankenspiel mehr. Die Öffnung hin zum Standort Dublin zeigt, dass der Prozess bereits begonnen hat. Der Wert einheitlicher Standards im Weltsport sollte dennoch so weit wie möglich hochgehalten werden.
Prof. Dr. Walther Michl, LL.M.Eur. (London) ist Inhaber der Professur für öffentliches Recht und Europarecht an der Universität der Bundeswehr München und ehrenamtlich im Verbands-Sportgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes aktiv.