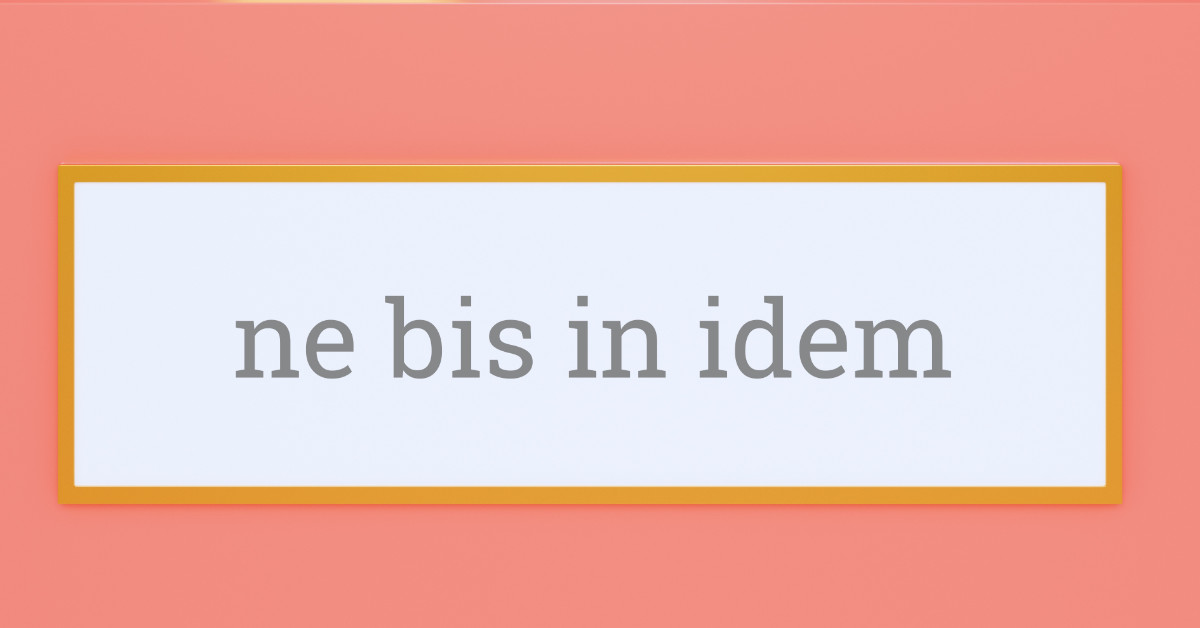Rechtssache bpost
Der Gesellschaft bpost wurden nacheinander von zwei nationalen Behörden Geldbußen auferlegt. Im Juli 2011 wurde gegen sie eine erste Geldbuße in Höhe von 2,3 Millionen Euro von der Regulierungsbehörde für den Postsektor verhängt, die feststellte, dass die von bpost ab dem Jahr 2010 angewandte Rabattregelung gegenüber bestimmten ihrer Kunden diskriminierend sei. Im März 2016 wurde diese Entscheidung von einem belgischen Gericht mit der Begründung aufgehoben, das Tarifsystem sei nicht diskriminierend. Im Dezember 2012 verhängte die Wettbewerbsbehörde gegen bpost eine Geldbuße in Höhe von etwa 37,4 Millionen Euro wegen Missbrauchs einer beherrschenden Stellung aufgrund der Anwendung dieser Rabattregelung in der Zeit von Januar 2010 bis Juli 2011. Die Gesellschaft bpost stellte die Rechtmäßigkeit dieses zweiten Verfahrens im Hinblick auf den Grundsatz ne bis in idem in Abrede.
Rechtssache Nordzucker
Der Oberste Gerichtshof in Österreich ist mit einem Rekurs der österreichischen Wettbewerbsbehörde in einem Verfahren befasst, in dem festgestellt werden soll, dass Nordzucker, ein deutscher Zuckerhersteller, gegen das Kartellrecht der Union sowie das österreichische Wettbewerbsrecht verstoßen habe, und in dem gegen Südzucker, einen weiteren deutschen Zuckerhersteller, aufgrund des gleichen Verstoßes eine Geldbuße verhängt werden soll. Dabei geht es unter anderem um ein Telefonat, bei dem Vertreter der Unternehmen über den österreichischen Zuckermarkt gesprochen haben, welches bereits von der deutschen Wettbewerbsbehörde in einer rechtskräftig gewordenen Entscheidung erwähnt wurde. Darin wurde ein Verstoß sowohl gegen das Unionsrecht als auch gegen das deutsche Wettbewerbsrecht festgestellt und eine Geldbuße in Höhe von 195,5 Millionen Euro gegen Südzucker verhängt.
EuGH: Kein striktes Verbot der Doppelbestrafung
Der Gerichtshof hat darauf hingewiesen, dass es kein striktes Verbot der Doppelbestrafung gebe: In bestimmten Fällen, wenn zum Beispiel Sanktionen den Wesensgehalt der Grundrechte achten würden und erforderlich seien und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen tatsächlich entsprächen, sei sie eingeschränkt zulässig. In der Rechtssache bpost stehe der Grundsatz ne bis in idem einer Sanktionierung wegen Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht nicht entgegen, wenn gegen das Unternehmen im Hinblick auf denselben Sachverhalt wegen Missachtung einer sektorspezifischen Regelung bereits eine endgültige Entscheidung ergangen sei.
Kumulierung von Verfolgungsmaßnahmen und Sanktionen möglich
Die Kumulierung von Verfolgungsmaßnahmen und Sanktionen setze jedoch das Bestehen klarer und präziser Regeln voraus, anhand deren sich vorhersehen lasse, bei welchen Handlungen und Unterlassungen eine Kumulierung in Frage komme und die die Koordinierung zwischen den beiden zuständigen Behörden ermöglichten. Außerdem müssten die beiden Verfahren in hinreichend koordinierter Weise und in engem zeitlichem Zusammenhang geführt worden sein und die Gesamtheit der verhängten Sanktionen muss der Schwere der begangenen Straftaten entsprechen. Andernfalls verstoße die zweite Behörde, die tätig werde, durch die Einleitung von Verfolgungsmaßnahmen gegen das Verbot der doppelten Strafverfolgung.
Sanktionierung durch unterschiedliche Wettbewerbsbehörden nicht ausgeschlossen
In der Rechtssache Nordzucker stehe dem Grundsatz ne bis in idem nicht entgegen, dass ein Unternehmen von der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats wegen eines Verhaltens, das im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats einen wettbewerbswidrigen Zweck oder eine wettbewerbswidrige Wirkung hatte, wegen eines Verstoßes verfolgt und mit einer Geldbuße belegt werde, obwohl dieses Verhalten bereits von einer Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaats in einer endgültigen Entscheidung erwähnt worden sei. Diese Entscheidung dürfe jedoch nicht auf der Feststellung eines wettbewerbswidrigen Zwecks oder einer wettbewerbswidrigen Wirkung im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats beruhen. Falls dies zutreffe, verstoße die zweite Wettbewerbsbehörde, die Verfolgungsmaßnahmen im Hinblick auf diesen Zweck oder diese Wirkung einleite, hingegen gegen das Verbot der doppelten Strafverfolgung.
Anwendbarkeit von ne bis in idem in Verfahren mit Kronzeugenregelung
Der Gerichtshof hat sich auch zur Anwendbarkeit des Grundsatzes ne bis in idem für Verfahren geäußert, in denen es zur Anwendung der Kronzeugenregelung gekommen ist und in denen keine Geldbuße verhängt wurde. Hierbei sei der Grundsatz ne bis in idem auf ein Verfahren zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechts anwendbar, in dem wegen der Teilnahme des betroffenen Beteiligten am nationalen Kronzeugenprogramm ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht lediglich festgestellt werden könne.