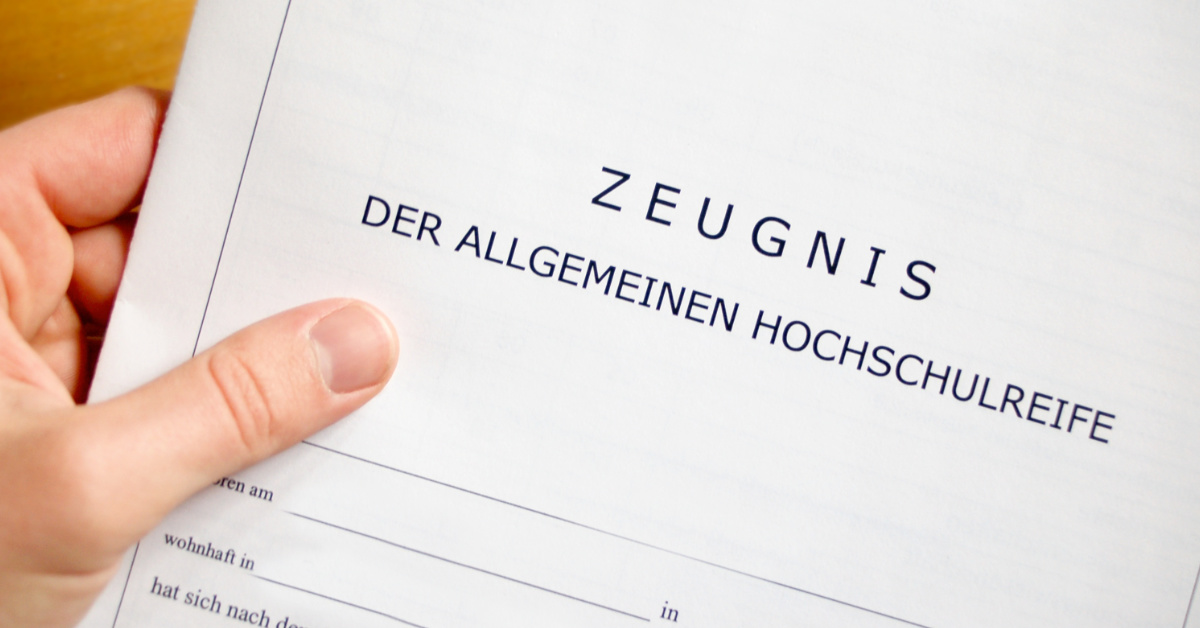Bayern gehört zu den Bundesländern, die für Schülerinnen und Schüler mit einer Lese-Rechtschreibstörung einen so genannten Notenschutz vorsehen. Wenn sie ihn beantragen, werden ihre Rechtschreibleistungen nicht bewertet. Sowohl die Nichtbewertung als auch die Legasthenie werden dann im Abiturzeugnis vermerkt.
Auch im Abiturzeugnis der drei klagenden Schulabgänger – allesamt litten an einer ärztlich bescheinigten Legasthenie – wurde 2010 vermerkt, dass ihre Rechtschreibleistungen krankheitsbedingt nicht benotet wurden. Bei Schülerinnen und Schülern mit anderen Behinderungen und in anderen Konstellationen, bei denen Einzelleistungen nicht bewertet wurden, war dies nicht der Fall. Durch diese Verwaltungspraxis fühlte sich das Schüler-Trio diskriminiert und zog bis vors Bundesverfassungsgericht – mit Erfolg.
Diese damalige bayerische Praxis, ausschließlich bei legasthenen Schülern eine Bemerkung im Zeugnis anzubringen, ist laut BVerfG jedenfalls nicht zumutbar und damit eine unzulässige Diskriminierung Behinderter, die gegen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG verstößt. Allerdings können derartige Zeugnisvermerke, die einem legitimen Ziel von Verfassungsrang dienten und erforderlich seien, durchaus auch angemessen und sogar verfassungsrechtlich geboten sein, stellt der Erste Senat klar (BVerfG, Urteil vom 22.11.2023 – BvR 2577/15, 1 BvR 2578/15, 1 BvR 2579/15).
BVerfG: Keine Rechtfertigung für Diskriminierung
Die damalige bayerische Verwaltungspraxis, so die obersten Verfassungsrichter, diskriminiere Legastheniker gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn solche Zeugnisvermerke unterblieben bei Mitschülerinnen und -schülern mit anderen Behinderungen, obwohl auch bei ihnen von der Bewertung einzelner Teilleistungen abgesehen wurde. Der chancengleiche Zugang wäre nur dann gewahrt gewesen, wenn die Nichtbewertung von Teilleistungen "generell im Zeugnis vermerkt worden wäre".
Die weiteren Ausführungen des BVerfG machen hingegen deutlich, dass die Karlsruher Richterinnen und Richter keine unzulässige Diskriminierung im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern ohne Behinderung erkennen, deren Rechtschreibleistungen im Abiturzeugnis bewertet wurden. Die Benachteiligung, die sich aus der Bemerkung über die Nichtbewertung ergebe, weil die Adressaten von Abiturzeugnissen daraus den Schluss ziehen würden, dass der Zeugnisinhaber insoweit Defizite aufweist, hält das BVerfG für geeignet und erforderlich, das verfassungsrechtliche Ziel eines leistungsbezogen chancengleichen Zugangs zu Ausbildung und Beruf zu fördern. Sie seien auch grundsätzlich angemessen. Dafür werfen die Verfassungsrichterinnen und -richter auch in die Waagschale, dass es den Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern überlassen ist, ob sie beantragen, dass die Rechtschreibleistung nicht bewertet wird.
Vor allem stellt der Senat aber darauf ab, dass das Abitur, dem der Gesetzgeber die allgemeine Hochschulreife beimesse, als breiter, allgemeiner Qualifikationsnachweis angelegt sei. Ohne einen solchen Vermerk über die Nichtberücksichtigung der Rechtschreibleistungen müsste man annehmen, dass alle Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer dieselben schulischen Kenntnisse erworben hätten, weil sie nach denselben Maßstäben bewertet worden wären. Das Abiturzeugnis wäre unwahr.
Das öffentliche Interesse daran, dass alle Schulabgänger eines Landes gleiche Chancen auf einen Zugang zu Ausbildung und Beruf bekommen, der ihren schulischen Leistungen entspricht, wäre ohne einen Vermerk im Abschlusszeugnis über eine ansonsten nicht erkennbare Nichtbewertung beeinträchtigt. Dieses öffentliche Interesse daran, transparent die tatsächlich erbrachten Leistungen erkennen zu können, überwiege grundsätzlich das Interesse der Betroffenen daran, nicht dadurch benachteiligt zu werden, dass in ihrem Abiturzeugnis steht, welche Leistung sie wegen ihrer Behinderung nicht erbracht haben. Nur dann eben, wenn ausschließlich diejenigen mit einer Lese-Rechtschreibstörung einen solchen Vermerk ins Zeugnis bekommen, nicht aber andere Schülerinnen und Schüler, die aus anderen Gründen ebenfalls teilweise nicht bewertet wurden, wie das im Jahr 2010 in Bayern der Fall war, sei diese Benachteiligung nicht zumutbar.