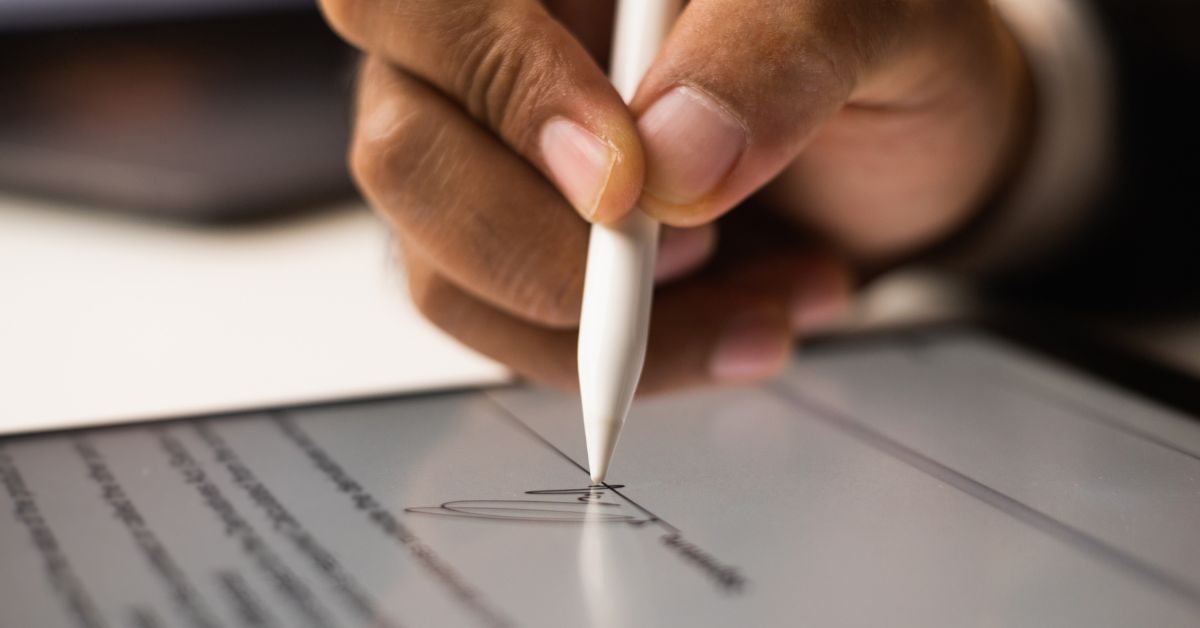Große Teile des Bürokratieentlastungsgesetzes IV (BEG IV), das noch von der Ampel-Regierung verabschiedet wurde, sind bereits am 1. Januar 2025 in Kraft getreten. Mit dem Vorsatz, die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung von überflüssiger Bürokratie zu entlasten, bringt es einige wichtige Erleichterungen bei Formerfordernissen für die arbeitsrechtliche Praxis mit sich. Zum 1. Mai dieses Jahres treten weitere Regelungen in Kraft, weshalb sich ein aktueller Blick auf das noch junge Gesetz lohnt.
Arbeitsverträge werden digital – aber nicht überall
Bislang galt aufgrund des § 2 Abs. 1 S.1 NachwG a. F. auch für Arbeitsverträge ein faktisches Schriftformerfordernis. Mit der Änderung des Nachweisgesetzes wird dem Arbeitgeber nunmehr die Möglichkeit gegeben, die wesentlichen Vertragsbedingungen abweichend zur Schriftform auch in Textform abzufassen und elektronisch zu übermitteln (§ 2 Abs. 1 S. 1 NachwG).
Diese besondere Textform darf genutzt werden, wenn das Dokument "für den Arbeitnehmer zugänglich ist, gespeichert und ausgedruckt werden kann" und "der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit der Übermittelung auffordert, einen Empfangsnachweis zu erteilen" (§ 2 Abs. 1 S. 1 NachwG). Was das genau bedeutet, könnte an dieser Stelle noch umfassend ausgeführt werden. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass der Arbeitgeber den Anforderungen des Nachweisgesetzes genügen wird, wenn er die Vertragsbedingungen als PDF-Datei an eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer per E-Mail versendet. Im Rahmen dessen genügt es für den Empfangsnachweis, wenn der Arbeitgeber die E-Mail mit der Empfangsbestätigungsfunktion ausstattet.
Vorsicht ist jedoch bei Befristungsvereinbarungen, nachträglichen Wettbewerbsverboten und in den Branchen des § 2a Abs. 1 SchwarzArbG (wie z. B. Bau- oder Gaststättengewerbe) geboten, bei welchen nach wie vor das strenge Schriftformerfordernis vorgesehen ist. In den genannten Fällen kann man dem zwar auch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur Genüge tun, allerdings stoßen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hier in der Praxis schnell an Grenzen, da Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selten über die nötigen technischen Möglichkeiten verfügen. Das Mittel der Wahl bleibt in der Praxis in diesen Fällen daher meist die handschriftliche Variante.
Auch wenn dem Arbeitgeber mit der Neuregelung in § 2 Abs. 1 S. 1 NachwG grundsätzlich die Wahl gelassen wird, die wesentlichen Arbeitsbedingungen auch in Textform an den Arbeitnehmer zu übermitteln, muss er sie weiter in Schriftform erteilen, wenn dieser das ausdrücklich verlangt (§ 2 Abs. 1 S. 3 NachwG) oder der Nachweis nicht (rechtzeitig) erteilt wurde (§ 2 Abs. 1 S. 4 NachwG).
Keine strenge Schriftform mehr bei Befristung bis zur Regelaltersgrenze
Wie bereits erwähnt, gilt für Befristungsvereinbarungen nach § 14 Abs. 1 TzBfG grundsätzlich weiterhin das strenge Schriftformerfordernis. Hiervon nimmt der Gesetzgeber nun aber die in der Praxis häufige Vereinbarung zur Befristung des Arbeitsverhältnisses bis zur Regelaltersgrenze (§ 41 Abs. 2 SGB VI) aus, für die jetzt die Textform genügt. Diese Änderung ist allerdings nur auf solche Befristungsvereinbarungen anwendbar, welche ab beziehungsweise nach dem 1. Januar 2025 geschlossen wurden.
Wichtig für die Praxis ist, dass solche Befristungsvereinbarungen des Arbeitsverhältnisses bis zur Regelaltersgrenze regelmäßig in den Arbeitsvertrag integriert sind. Dient der Arbeitsvertrag gleichzeitig zur Erfüllung der Verpflichtungen unter dem Nachweisgesetz, muss man das besondere Textformerfordernis des NachwG beachten.
Arbeitszeugnisse und Arbeitnehmerüberlassung: Der Teufel steckt im Detail
Das BEG IV macht es Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern künftig auch möglich, mit Einwilligung der Angestellten Arbeitszeugnisse in elektronischer Form zu erteilen (§ 109 Abs. 3 GewO). Was zunächst nach einem Fortschritt aussieht, ist bei genauerem Blick für die Praxis aufgrund der Anforderung an die elektronische Form leider mit großen Hürden verbunden. Der Gesetzgeber verweist nämlich mit seiner Formulierung der "elektronischen Form" auf die gesetzliche elektronische Form des § 126a BGB, weshalb auch dessen Anforderungen gelten. Dies bedeutet, dass einfach digital signierte elektronische Textdateien nicht ausreichen, sondern es einer qualifizierten elektronischen Signatur bedarf. Diese steht aufgrund von Kosten- und Zeitgründen allerdings nicht immer zur Verfügung.
Das könnte in der Praxis dazu führen, dass die meisten Unternehmen weiterhin bei der klassischen Schriftform bleiben. Selbst nach Zugang der Einwilligungserklärung steht Ihnen noch ein Wahlrecht zu, in welcher Form sie das Zeugnis erteilen wollen.
Auch im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung hat sich der Gesetzgeber ein paar Entlastungen einfallen lassen. So genügt zwischen den Unternehmen fortan die Textform für die Ausfertigung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrages (§ 12 Abs. 1 S. 1 AÜG). Folglich ist auch dem Betriebsrat im Rahmen der Anhörung nach § 99 Abs. 1 BetrVG eine Erlaubniserklärung des Verleihers nur in Textform vorzulegen (§ 14 Abs. 3 S. 2 AÜG).
Nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers bleibt das Leiharbeitsverhältnis zwischen dem Verleiher und dem Leiharbeitnehmer, bzw. der Leiharbeitnehmerin von dieser Änderung unberührt. Allerdings finden die Bestimmungen des NachwG zum reformierten Textformerfordernis auch hier Anwendung. Zu beachten sind hierbei aber die zusätzlichen in § 11 Abs. 1 AÜG genannten Angaben, welche in die wesentlichen Arbeitsbedingungen mit aufgenommen werden müssen.
Elternzeit, Pflege, Mutter- und Jugendschutz
Auch im Hinblick auf die Geltendmachung des Anspruchs auf Elternzeit, Pflegezeit bzw. Familienpflegezeit bietet das BEG IV Erleichterungen an. Ab dem 1. Mai besteht die Möglichkeit, diese Ansprüche in Textform geltend zu machen (§ 16 Abs. 1 S. 1 BEEG, § 3 Abs. 3 S.1 PflegeZG, § 2a Abs. 1 S. 1 FPfZG). Darüber hinaus gelten entsprechende Formerleichterungen auch für den Antrag auf Teilzeit während der Elternzeit und die Ablehnung des Arbeitgebers (§ 15 Abs. 7 BEEG).
Dies vereinfacht zwar die Antragsprozesse in der Praxis, dort könnte aber gerade der Beweis des Zugangs Probleme aufwerfen. Deshalb ist auch hierbei, gerade bei einem Rückgriff auf den E-Mail-Verkehr, die Nutzung der Empfangsbestätigungsfunktion dringend zu empfehlen.
Weitere kleinere Änderungen gibt es im Bereich der Arbeitszeit, beim Jugendarbeitsschutz und beim Mutterschutz:
Gerade die Aushangpflichten des Arbeitgebers im Bereich der Arbeitszeit und des Jugendarbeitsschutzes werden vereinfacht. Firmen können Informationen, die bisher physisch ausgehängt werden mussten, künftig elektronisch bereitstellen (§ 16 Abs.1 ArbZG, § 47 JArbSchG). Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ungehinderten Zugang zu den Informationen haben. Dies wird in der Praxis regelmäßig durch das Intranet zu bewältigen sein – diese Option wird auch ausdrücklich vom Gesetzgeber genannt.
Darüber hinaus wird im Jugendarbeitsschutz die Textform bei schriftlichen Handlungen nach dem JArbSchG zur Regel, sofern keine der ausdrücklich genannten Ausnahmen betroffen sind.
Im Bereich des MuSchG besteht grundsätzlich die Pflicht des Arbeitgebers zur Arbeitsplatzbeurteilung für den Fall, dass auf diesem eine schwangere oder stillende Frau eingesetzt wird. Diese Pflicht entfällt nun, falls der Ausschuss für Mutterschutz eine einschlägige Regel getroffen hat (§ 10 Abs. 1 MuSchG).
Ein Anfang ist gemacht – bitte mehr davon!
Die Maßnahmen des BEG IV sind für die arbeitsrechtliche Praxis ein Schritt in die richtige Richtung. Die antiquierte Schriftform bedeutete schon immer einen kaum rechtfertigbaren Aufwand. Zwar stellte die bereits überwiegend nutzbare Alternative der qualifizierten elektronischen Signatur eine erste Maßnahme der Lockerung dar. Aufgrund der hohen Hürden in der Praxis ist diese aber selten genutzt worden. Die Erweiterung des Anwendungsbereiches der Textform dürfte daher in der arbeitsrechtlichen Praxis für Erleichterung sorgen.
Durch die Möglichkeit, einen Arbeitsvertrag oder Elternzeitantrag elektronisch zu übermitteln oder einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag per E-Mail abzuschließen, werden die versprochene Digitalisierung und der Bürokratieabbau im arbeitsrechtlichen Alltag für alle Beteiligten ein wenig spürbarer. Dennoch ist das weiterhin geltende strenge Schriftformerfordernis, etwa für Kündigungen, Aufhebungsverträge, Befristungsabreden, nachträgliche Wettbewerbsverbote und Wertguthabenvereinbarungen, stets zu beachten, da diese nicht von den Änderungen des BEG IV erfasst sind. Ob weitere Änderungen und Erleichterungen diesbezüglich erfolgen werden, bleibt mit dem aktuellen Regierungswechsel abzuwarten – wünschenswert wäre es aber in jeden Fall!
Dr. Hagen Köckeritz, LL.M oec. int. ist Partner am Frankfurter Standort der Kanzlei Mayer Brown und berät Mandantinnen und Mandanten in allen arbeitsrechtlichen Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmensumstrukturierungen, nationalen und internationalen Fusionen und Übernahmen sowie Outsourcing. Philipp von Cornberg ist Rechtsreferendar in Konstanz und gegenwärtig in Ausbildung am Frankfurter Standort von Mayer Brown.