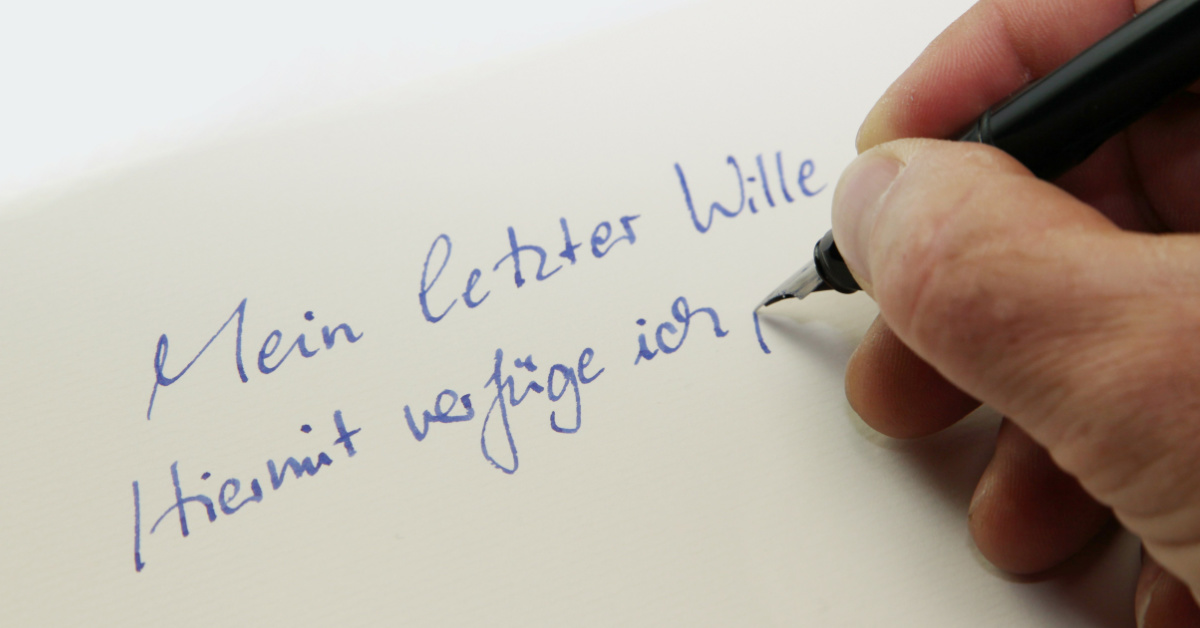"Erbengemeinschaft aus 5 befreundeten Familien"
Ein Ehepaar hatte in einem handschriftlichen Testament auch die Frage geregelt, wer nach dem Tod beider Partner Nacherbe werden sollte. Für einen Teil des Erbes hatte es Folgendes bestimmt: "Erbteil P. /I. fällt an eine Erbengemeinschaft aus 5 befreundeten Familien, da … [die Ehefrau] außer ihrem Ehemann keine Erben hat … Namen und Adressen für das Erbteil I. sind im PC-Ausdruck angehängt und persönlich unterschrieben." Während das Amtsgericht Groß-Gerau zweien der Freunde noch einen Erbschein ausstellte, erklärte das OLG Frankfurt am Main auf die Beschwerde der Tochter hin die Erbeinsetzung für unwirksam. Für einen Dritten sei ohne Rückgriff auf die nicht in Testamentsform erstellte Anlage die Identität der Erben nicht zu bestimmen. Der BGH schloss sich dieser Auffassung an.
Klarheit des Testaments
Dabei räumten die Karlsruher Richter – wie zuvor schon das OLG – durchaus ein, dass die Freunde nach dem Willen des Paares wahrscheinlich hätten erben sollen. Dies lasse sich aber nicht aus dem Testament herauslesen. Denn auch durch Auslegung sei nicht bestimmbar, welche Familien zum Kreis der bedachten Personen gehören sollten. Dabei ist nach Ansicht des IV. Zivilsenats die testamentarische Erwähnung von fünf Familien kein ausreichender Anhaltspunkt für eine Andeutung des Erblasserwillens. Dieser ergebe sich hier nur aus der Anlage, die nicht handschriftlich und damit formnichtig errichtet worden sei. Insgesamt sei die Erbeinsetzung durch den hier unverzichtbaren Rückgriff auf die Erbenliste nach den Grundsätzen des "testamentum mysticum" unwirksam. Die obersten Zivilrichter kritisierten in diesem Zusammenhang eine Verwischung der Trennlinien durch die bisher in der Rechtsprechung übliche Unterscheidung in eine zulässige Erläuterung des erklärten Willens und eine unzulässige Inhaltsbestimmung des Testaments. Teilweise seien zu großzügig Verweisungen auf formnichtige Anlagen akzeptiert worden.