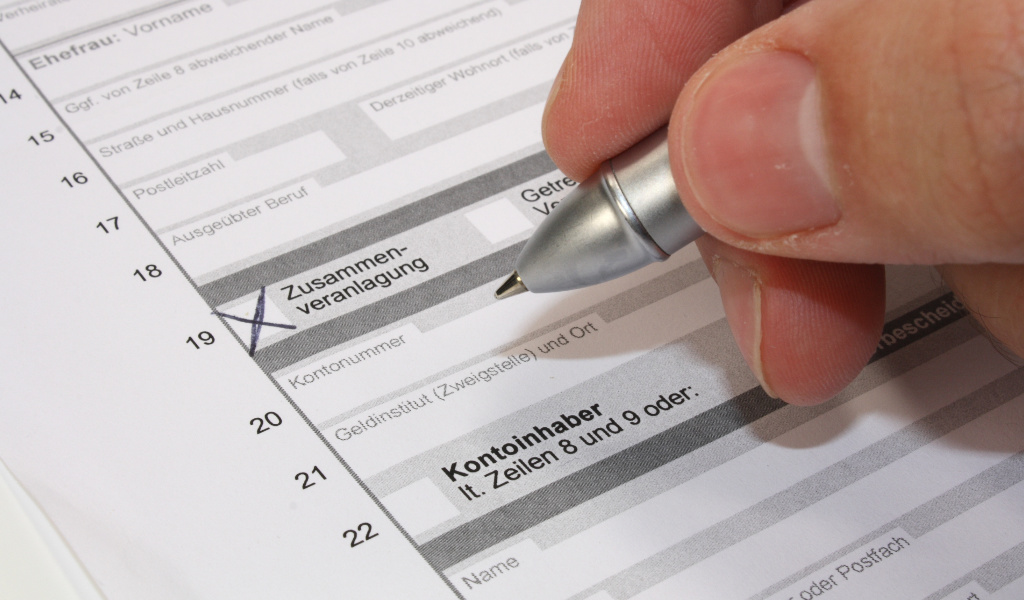Streit um die Berechnungsmethode
Eine Ehefrau lag im Streit um die Methode der Berechnung eines vom beklagten Haftpflichtversicherer zu ersetzenden Steuerschadens. Sie war 2002 bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, für den die Versicherung voll haftete. Die Gesellschaft wurde in einem Vorprozess verurteilt, der Geschädigten "[...] alle sich aus dem Verdienstausfall (…) sowie aus dem bereits bezahlten Nettoverdienstausfallschaden von 20.000 Euro ergebenden Steuern zu ersetzen". Die mit ihrem Mann zur Einkommensteuer veranlagte Frau machte geltend, im Jahr 2017 durch den geleisteten Ersatz ihres Nettoverdienstausfallschadens einen Steuerschaden von 5.270 Euro erlitten zu haben. Mit dieser Rechnung war der Versicherer nicht einverstanden und zahlte nur 2.000 Euro. Sowohl beim AG Freudenstadt als auch beim LG Rottweil hatte die auf Zahlung der Differenz von 3.270 Euro gerichtete Klage Erfolg: Entgegen einer Entscheidung des BGH von 1970 sei die Klägerin für die Ermittlung des Steuerschadens so zu behandeln, wie sie tatsächlich veranlagt worden sei. Eine (fiktive) Berechnung auf Grundlage allein ihres Einkommens führe nicht zu einem vollen Ausgleich des Schadens entsprechend § 249 BGB.
BGH: Gesetzliche Zusammenveranlagung ist entscheidend
Dem stimmte der BGH zu und wies die Revision der Haftpflichtversicherung zurück. Soweit die frühere Entscheidung als generelle Aussage dahingehend verstanden worden sei, dass fiktiv nach dem isolierten Einkommen des Geschädigten abzurechnen sei, werde hieran nicht festgehalten. Bei dem von der Frau geltend gemachten Steuerschaden handele es sich in voller Höhe um eine eigene Steuerschuld aus gemeinsamem Einkommen. Auch wenn das Unfallopfer nach §§ 268 ff. AO beantragen könne, dass insoweit gegen sie nur wegen des Betrags vollstreckt werde, der sich bei einer fiktiven Einzelveranlagung ergäbe, bliebe ihre Gesamtschuldnerschaft als solche unberührt. Dabei handelt es sich den Bundesrichtern zufolge nicht um das Ergebnis einer besonderen steuerlichen Gestaltung; die Durchführung der Zusammenveranlagung sei vielmehr gesetzlich angeordnet. Es verwirkliche sich insoweit auch kein unfall- oder schadensbedingter Vorteil der Ehefrau, sondern um einen davon unabhängigen steuerlichen Vorteil der zusammenveranlagten Eheleute. Dieser wäre ihnen auch ohne das schädigende Ereignis zugutegekommen. Der Schädiger habe den Geschädigten insoweit auch in steuerlicher Hinsicht so zu nehmen, wie er sei.