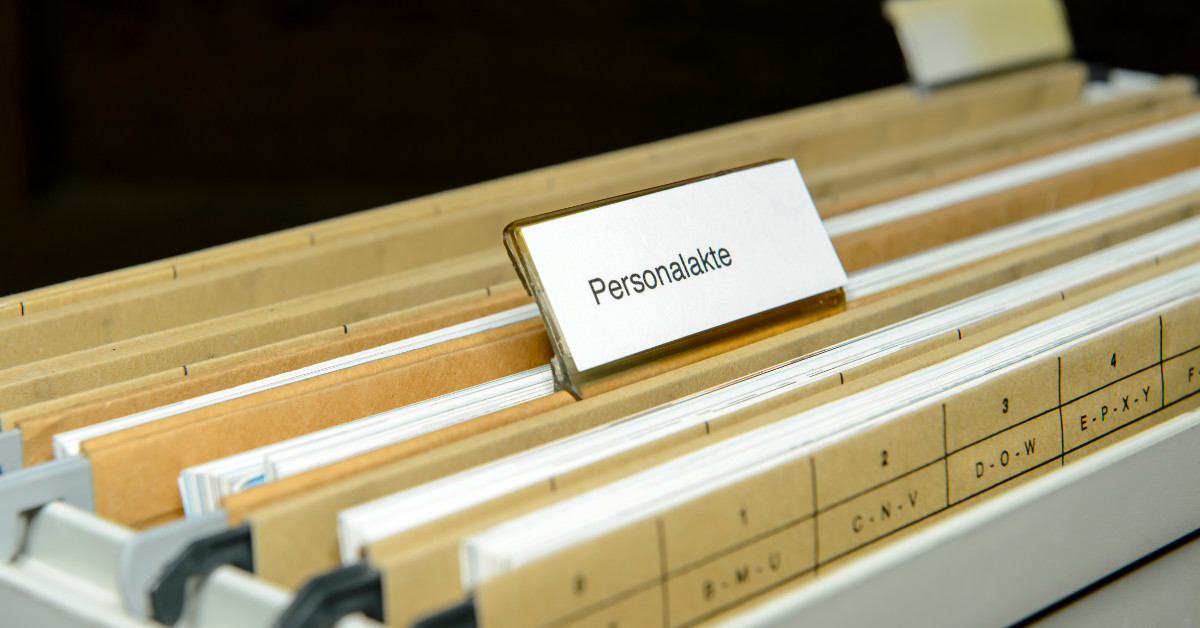Eine Bundesbeamtin hat vor dem BGH gegen die Bundesrepublik Deutschland einen Sieg erstritten – nachdem sie vor dem LG Hannover und dem OLG Celle noch verloren hatte. Seit 1995 arbeitet sie bei einer in der niedersächsischen Hauptstadt ansässigen Bundesanstalt. Die Personalakten wurden dort früher von Bediensteten des Landes verwaltet. Das beanstandete die Frau mehrfach ohne Erfolg; im Jahr 2017 wandte sie sich schließlich an den niedersächsischen Datenschutzbeauftragten, der die Eingabe an den Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit weiterleitete. Dieser teilte dem Bund zwei Jahre später mit, dass die Praxis unzulässig sei. Das Bundesland änderte daraufhin die monierte Vorgehensweise.
Etwas kompliziert wurde der Fall dadurch, dass die Staatsdienerin zuvor auch noch wegen Mobbings geklagt hatte. Dieser Vorwurf spielte aber keine Rolle mehr, als der Prozess bei den obersten Zivilrichtern anlangte, und ließ diese auch nicht an der Zulässigkeit des nur noch teilweise weiterverfolgten Feststellungsantrags zweifeln. Maßgeblich war für den VI. Zivilsenat in der heute veröffentlichten Entscheidung: Es lag ein Verstoß gegen Art. 82 Abs. 1 DS-GVO vor (den die Landesbehörde auch eingeräumt und deshalb mittlerweile abgestellt hatte) – und der begründe einen Anspruch der Beamtin auf Schadensersatz (Urteil vom 11.02.2025 – VI ZR 365/22).
"Vorübergehender Kontrollverlust"
Die Verletzung des Datenschutzrechts sahen die Karlsruher Richter darin, dass die Aktenverwaltung der Bundesbeamtin durch Landesbeamte nicht von § 111a BBG a.F. i.V.m. § 26 BDSG und Art. 88 DS-GVO gedeckt gewesen sei. Dies verletzte konkret Art. 5 Abs. 1 Buchst. a sowie Art. 28 DS-GVO. Auch liegt dem Urteil zufolge durchaus ein Schaden vor – nämlich in dem "vorübergehenden Verlust der Kontrolle der Klägerin über ihre in ihrer Personalakte enthaltenen personenbezogenen Daten", der durch die Überlassung an Landesbedienstete verursacht worden sei. Hierbei beruft sich der BGH auf die Rechtsprechung des EuGH (vgl. zuletzt Urteil vom 04.10.2024 – C-200/23) sowie auf seine eigene. Denn der Verpflichtung zum Ausgleich müsse keine über diesen Kontrollverlust hinausgehende "benennbare und insoweit tatsächliche Persönlichkeitsrechtsverletzung gegenüberstehen". Außerdem habe der Beeinträchtigung eines Betroffenen kein besonderes Gewicht zuzukommen, das "über eine individuell empfundene Unannehmlichkeit hinausgeht oder das Selbstbild oder Ansehen ernsthaft beeinträchtigt".
Damit liegt nach Ansicht der Bundesrichter hier ohne Weiteres ein Schaden darin, dass Niedersachsen Informationen über die Beschäftigte "nicht berechtigten Dritten", nämlich eigenen Bediensteten, zur Bearbeitung überlassen hatte. Dass auch die mit Personalangelegenheiten betrauten Mitarbeiter des Landes zur Verschwiegenheit verpflichtet waren, steht der Annahme eines Schadens aus Sicht des BGH nicht entgegen. Das sei erst bei der Bemessung der Schadenshöhe zu berücksichtigen. Ein letztes Verteidigungsargument schnitten die Bundesrichterinnen und -richter den Behörden zwischen Ems und Elbe ebenfalls ab: § 839 Abs. 3 BGB schließe zwar eine Ersatzpflicht bei einer Amtspflichtverletzung aus, wenn der Betroffene es unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Doch dies sei auf den unionsrechtlichen Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO nicht übertragbar.