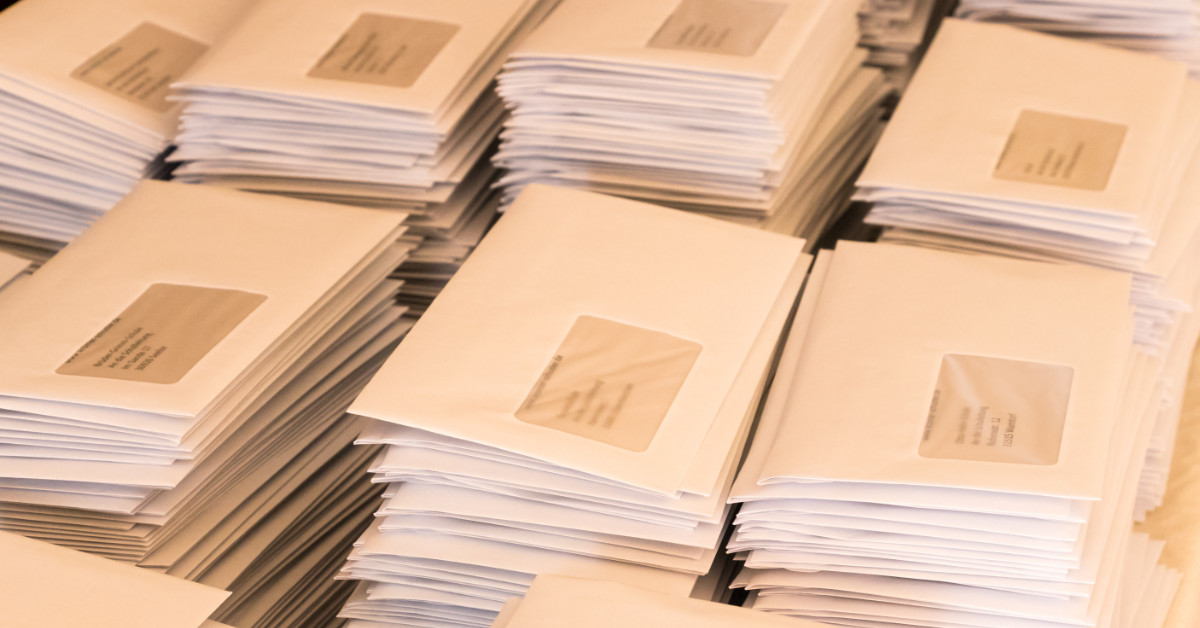Die Anwaltskammer Berlin verklagt die Bundesnetzagentur (BNetzA) wegen zu hoher Porti – sechs Jahre, nachdem sie erstmals erhoben wurden. Das VG hält ihr Klagerecht für verwirkt: Die RAK hätte es besser wissen müssen, schließlich sei sie die Selbstverwaltungsorganisation der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Aber muss eine Kammer in eigener Sache stets über umfassende Rechtskenntnisse verfügen oder kann sie sich in bestimmten Konstellationen nicht doch darauf zurückziehen, sie habe nichts gewusst?
(Zu) teure Werbeantworten
Als Behörde ist die BNetzA dazu berufen, Briefentgelte der Post zu genehmigen. Die genehmigten Tarife seien zu hoch, meint die Kammer. Ihr entstünden dadurch übermäßige Kosten, insbesondere durch die Bezahlung von Stimmabgaben im Rahmen einer Briefwahl des Vorstandes.
Die Anwaltskammer gibt dazu den Mitgliedern nämlich Stimmzettel aus, die in einem vorbereiteten Umschlag mit der Aufschrift "Porto zahlt Empfänger" zurückgesandt werden können. Im Tarifgefüge der Post wird das interessanterweise als "Werbeantwort Standardbrief" bezeichnet. Die Werbung um Stimmen ist offenbar auch eine Werbung im postalischen Sinne.
Entgeltgenehmigungsbeschlüsse der BNetzA wurden in den Jahren 2015, 2018 und zuletzt – soweit hier relevant – am 12. Dezember 2019 gefasst und unter anderem am 22. Januar 2020 in ihrem Amtsblatt veröffentlicht. Eine direkte Zustellung dieser Verwaltungsakte erfolgte lediglich an die zum Verfahren Beigeladene, die Deutsche Post, dort mit einer ordentlichen Rechtsbehelfsbelehrung, wonach innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht erhoben werden könne. Die Anwaltskammer, die über nichts belehrt wurde und keinen Bescheid erhielt, klagte erst am 29. September 2021, mithin über sechs Jahre seit dem Beginn der Beförderung ihrer Briefe zu diesem Tarif.
VG Köln: Verwirkung
Verglichen mit den 6.000 Euro Kosten, welche die Rechtsanwaltskammer für die vergangenen Wahlen ins Feld führt und von denen allenfalls ein Bruchteil unrechtmäßig erhoben sein könnte, wenn die BNetzA unterläge, ist die aufgewandte juristische Phantasie nachgerade überbordend, insbesondere in Bezug auf die von Beklagtenseite geltend gemachte Verwirkung. Man habe doch nichts von der Frist gewusst, lässt die Kammer wissen, die Rechtsprechung dazu sei spärlich und entlegen. Sowieso würden täglich neue Beförderungsverträge abgeschlossen, angesichts der Gesamtumsätze der Post seien die bei der Kammer aufgelaufenen Beträge marginal. Da wird ein Vergleich mit dem Kommunalabgabenrecht gezogen, das unionsrechtliche Effektivitäts- und Äquivalenzprinzip bemüht, Kartellrecht und Verbraucherschutz. Alle Genehmigungsbeschlüsse seien aufzuheben.
Die BNetzA hält entgegen: In der Konsequenz der Argumente der RAK müssten "Milliarden" an Postsendungen einbezogen werden, über die gar keine Unterlagen vorlägen, das sei unzumutbar, widerspräche auch dem öffentlichen Interesse (am Rechtsfrieden natürlich). Wenn man schon vergleiche, dann am ehesten mit dem Baunachbarschaftsverhältnis.
Die Kammer sei zur Klage befugt und habe auch keine Frist versäumt, sagt das Verwaltungsgericht, da die Bekanntgabe der Genehmigungen nicht ordnungsgemäß erfolgt sei. Aber am Ende soll tatsächlich Verwirkung durchgreifen. Das Gericht prüft die dafür nach Treu und Glauben notwendigen Momente: Zeitablauf (über ein Jahr), Umstände und Vertrauen.
Kennen und Kennenmüssen
Für die subjektive Komponente stellt das VG auf ein "Kennenmüssen" von einem Verwaltungsakt und einer daraus resultierenden "Möglichkeit zur Klageerhebung" ab. Die Kammer habe ihr Klagerecht spätestens seit Anfang 2016 - d.h. seit der regelmäßigen Inanspruchnahme der genannten Leistungen – kennen müssen, so das VG. Dass die Entgelte auf einer Genehmigung beruhten, ergebe sich unmittelbar aus den §§ 19 ff. PostG und dass auch Endkunden dagegen klagen können, sofern sie die Leistung in Anspruch genommen haben, sei seit 2015 in der Rechtsprechung anerkannt.
Dass die Klägerin beides nicht gewusst habe, erkennt das VG als möglich, wenngleich für den ersten Umstand "schon sehr unwahrscheinlich" an. Dies sei jedoch schon deswegen unerheblich, da sie die Selbstverwaltungsorganisation der in Berlin zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sei. Eine solche Organisation müsse "sämtliche rechtlichen Umstände, auf die sie sich einlässt, kennen", zumal die Klägerin regelmäßig ein höheres Portovolumen bei der Beigeladenen generiert habe.
Von daher könne sogar dahinstehen, ob hier auch ein besonderes Treueverhältnis bestand (was das VG indes bejaht), aufgrund dessen sie zur Einholung von Rechtsrat gehalten gewesen wäre. Zwar habe die Klägerin zunächst nicht wissen müssen, dass die jetzt angegriffene Entgeltgenehmigung rechtswidrig war, denn dies habe sich letztinstanzlich erst 2020 herausgestellt. Anknüpfungspunkt sei allerdings stets der Verwaltungsakt. Die Eröffnung von Klagerechten gegen einen Verwaltungsakt könne nicht von dessen Rechtmäßigkeit bzw. deren Kenntnis abhängen.
VG dogmatisch auf dünnem Eis
Über die Sprungrevision der Anwaltskammer wird am Mittwoch verhandelt. Das BVerwG wird sich mit der Frage beschäftigen müssen, ob eine Anwaltskammer per se daran gehindert ist, sich auf rechtliche Unkenntnis in irgendeinem ihrer Tätigkeitsbereiche zu berufen, so wie es das VG kühn behauptet.
Ich finde, man muss differenzieren. Im Kern der Aufgaben, in der Anwendung des Berufsrechts gegenüber Mitgliedern etwa, muss sich die Kammer auskennen. Im Hinblick auf Briefbeförderungsentgelte verfügt eine Selbstverwaltungskörperschaft von Anwälten aber nicht über überlegenes Wissen, sondern agiert wie jede andere Organisation. Die Anwaltskammer ist nicht zu allgemeiner Rechtsberatung befugt und hat daher gar keine Veranlassung dazu, Know-how in jedem Rechtsbereich aufzubauen, erst recht gilt das für Orchideenfächer wie das Postrecht. Hier musste sich auch nicht der Gedanke aufdrängen, man bedürfe spezialisierter rechtlicher Beratung. Das VG hat insoweit meines Erachtens zu streng geurteilt.
Dabei ist das Ergebnis, zu dem das VG gelangt, nicht unvernünftig: Die Möglichkeit nachträglicher Entgeltklagen bedarf einer Beschränkung, weil das enorme Volumen, das die Deutsche Post täglich bewegt, eine Rückabwicklung über lange Zeiträume praktisch ausschließt. Diese Beschränkung wäre indes Aufgabe des Gesetzgebers. Bei der Lektüre der erstinstanzlichen Entscheidung kann ich mich des Eindrucks kaum erwehren, als hätte das Gericht das fiskalisch vernünftige Ergebnis einer Begrenzung der Klagemöglichkeit im Gesetz nicht gefunden, sich dann aber mit dem Instrument der Verwirkung zum Ersatzgesetzgeber aufgeschwungen. Ob das BVerwG auf diesem dogmatisch dünnen Eis mitgeht?
Rechtsanwalt Prof. Dr. Volker Römermann, CSP, ist Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG und Direktor des Humboldt Center for the Legal Profession an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 27 Jahren berät und vertritt der Autor im anwaltlichen Berufsrecht.