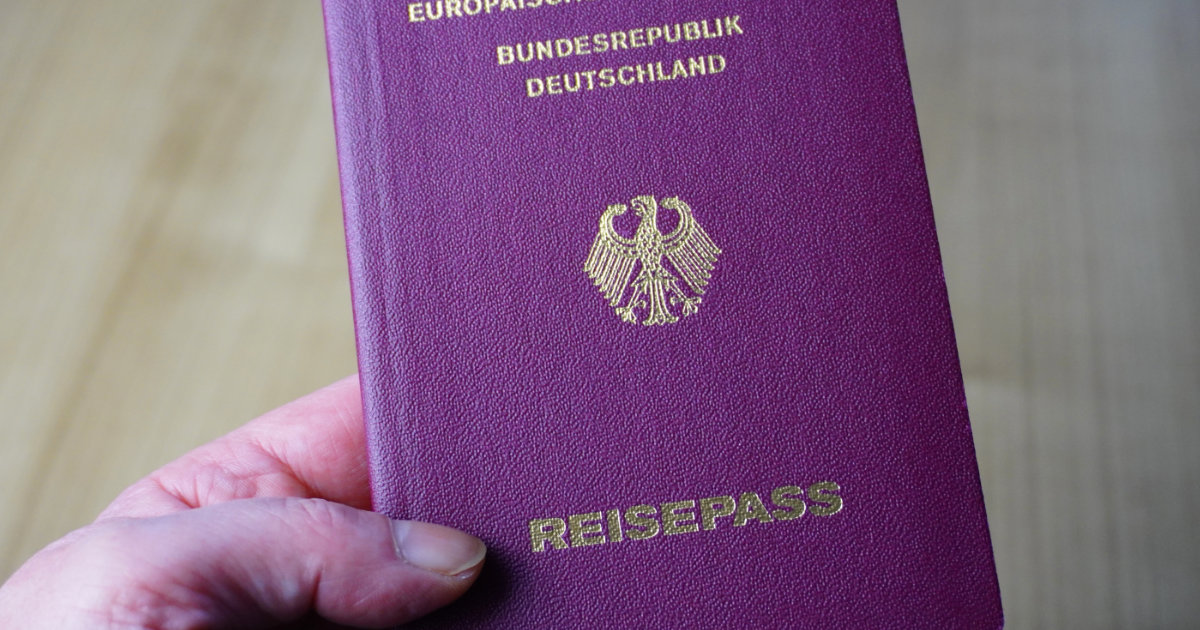Der Fokus auf die Migrationspolitik im aktuellen Wahlkampf führt immer wieder zu Vorschlägen, die für heftige Diskussionen sorgen, gerade nach den Anschlägen von Magdeburg und Aschaffenburg. So forderte Friedrich Merz, Kanzlerkandidat der CDU, Anfang des Jahres, Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft bei Straffälligkeit zu entziehen. Diese Forderung wurde sowohl als verfassungswidrig bezeichnet als auch dafür kritisiert, die polarisierte migrationspolitische Debatte durch ein Bild von „Bürgern zweiter Klasse“ weiter zu verschärfen. Die Forderung suggeriert gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Dabei gilt bereits jetzt, dass eine Einbürgerung an bestehenden Vorstrafen scheitert, mit Ausnahme von „Bagatellstrafen“, darunter solchen unter 90 Tagessätze oder Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten auf Bewährung, die aber nicht antisemitisch, rassistisch oder ansonsten menschenverachtend motiviert sein dürfen. In bestimmten Ausnahmefällen kann eine Person die deutsche Staatsangehörigkeit auch wieder verlieren. Allerdings unterliegt ein solcher Verlust sehr strengen gesetzlichen Voraussetzungen. Denn die deutsche Staatsangehörigkeit ist verfassungsrechtlich geschützt.
Verfassungsrechtlicher Schutz der Staatsangehörigkeit
Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, so Art. 116 I GG. Dabei kennt das Grundgesetz keine Unterscheidung zwischen gebürtigen oder eingebürgerten Deutschen und auch keinen übergeordneten Abstammungsgrundsatz, wie das BVerfG in seinem NPD-Urteil von 2017 (NJW 2017, 611) klargestellt hat. Die Staatsangehörigkeit darf grundsätzlich nicht entzogen werden, so Art. 16 I 1 GG. Ein Verlust darf nach Art. 16 I 2 GG nur auf Grund eines Gesetzes erfolgen und gegen den Willen der betroffenen Person nur dann, wenn diese dadurch nicht staatenlos wird. Letzteres ist auch ein völkerrechtliches Ziel, das im UN-Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 1961 festgeschrieben ist. Zudem schreibt das Europäische Übereinkommen zur Staatsangehörigkeit von 1997 fest, dass ein Vertragsstaat den Verlust der Staatsangehörigkeit nur in wenigen Ausnahmefällen gesetzlich vorsehen kann.
Verlust der Staatsangehörigkeit nach dem StAG
Entsprechend diesen Vorgaben ist der Verlust der Staatsangehörigkeit im Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) in § 17 geregelt. Danach geht sie durch Verzicht (§ 26 StAG) sowie in ganz bestimmten Fällen verloren, die eine Abkehr von Deutschland erkennen lassen: Bei Eintritt in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates oder durch konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 28 StAG). Schließlich ist der Verlust auch durch die behördliche Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts möglich (§ 35 StAG). Diese Regelung reagiert auf missbräuchliches Verhalten während des Einbürgerungsverfahrens, so etwa in Fällen arglistiger Täuschung, Drohung oder Bestechung. Hier sieht § 35 StAG sogar vor, dass eine drohende Staatenlosigkeit dieser Rücknahme in der Regel nicht entgegensteht (§ 35 II StAG). Dafür ist diese Rücknahme nur bis zu zehn Jahre nach der Bekanntgabe möglich. Dieses zeitliche Erfordernis beruht auf einer Entscheidung des BVerfG von 2006 (NVwZ 2006, 807 = NJW 2006, 2542 [Ls]). Das Urteil verdeutlicht, dass bei jeder Entscheidung über den Verlust der Staatsangehörigkeit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren ist.
Die strengen verfassungsrechtlichen Vorgaben für den Verlust der Staatsangehörigkeit sind wesentlich für den Rechtsstaat, denn sie stellen eine grundgesetzliche Antwort auf die massiven Ausbürgerungen während der NS-Zeit dar. Ein Verlust der Staatsangehörigkeit als Sanktionsinstrument für mögliche künftige Straftaten ohne Bezug zu einem Loyalitätsbruch und die damit verbundene Abwertung der doppelten Staatsangehörigkeit ist mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen daher nicht vereinbar. Schließlich ist das Rechtsgebiet, das den Umgang mit Straftaten und straffälligen Menschen jedweder Staatsangehörigkeit regelt, das Strafrecht, nicht das Staatsangehörigkeitsrecht.
Dieser Inhalt ist zuerst in der NJW erschienen. Sie möchten die NJW kostenlos testen? Jetzt vier Wochen gratis testen inkl. Online-Modul NJWDirekt.)