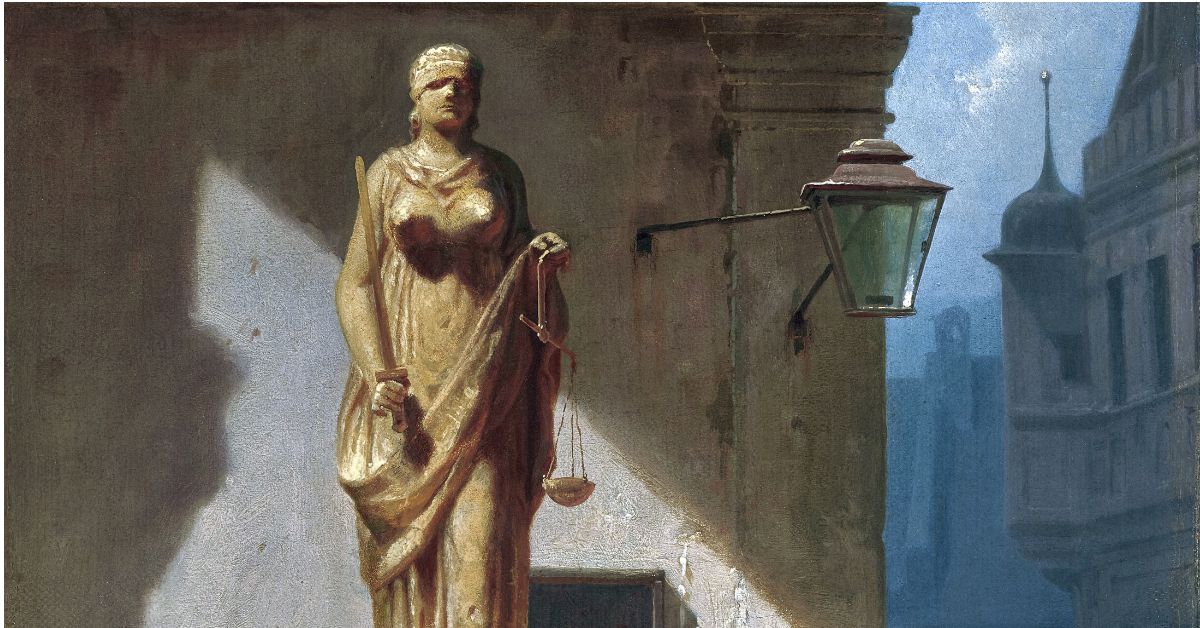Die im vergangenen Jahr getroffene Entscheidung des Bundeskabinetts und der Länder, das 2003 ins Leben gerufene Streitschlichtungsgremium „Beratende Kommission NS-Raubgut“ durch ein normatives Schiedsgerichtsverfahren zu ersetzen, wirft gravierende Fragen auf. Trotz der Einwände führender Experten und betroffener Nachfahren aus aller Welt, wie in einem Offenen Brief vom 7.1.2025 an Bundeskanzler Olaf Scholz dargelegt, wird dieser Paradigmenwechsel vorangetrieben. Der Schritt erscheint nicht nur unüberlegt, sondern auch kontraproduktiv im Umgang mit Deutschlands historischer Verantwortung, denn die geplante Einführung einer Schiedsgerichtsbarkeit zur Restitution von NS-Raubgut weist Stärken und Schwächen auf.
Während verbindliche Standards und ein formalisiertes Verfahren als Fortschritte gegenüber dem bislang unverbindlichen Verfahren, namentlich mittels „Empfehlungen“ seitens Kommission (auch „Limbach-Kommission“ genannt), gesehen werden, stehen demgegenüber Einschränkungen des Anwendungsbereichs, mangelnde Transparenz sowie die fehlende Einbindung wichtiger Opfergruppen und unabhängiger Experten in der Kritik. Die Ausarbeitung der Schiedsgerichtsordnung und des dazugehörigen, quasi-gesetzesgleichen „Bewertungsrahmens“ als verfahrens- und materiellrechtlich verbindliche Richtschnur, erfolgte offensichtlich unter Ausschluss vieler relevanter Akteure, was – gerade bei einer dermaßen hochpolitischen und historisch belasteten Thematik – dem Grundsatz der fraglos gebotenen völligen Transparenz widerspricht. Die Opfer des NS und ihre Nachkommen wurden im Vorfeld nicht ausreichend beteiligt und die Reform wird hauptsächlich durch Verwaltungsabkommen anstelle eines demokratisch legitimierten Gesetzgebungsprozesses umgesetzt. Dies führt zu einem Demokratiedefizit und schädigt das Vertrauen in die Legitimierung und Akzeptanz der Entscheidungen. Der enge Anwendungsbereich der Schiedsgerichtsbarkeit schließt viele, in Deutschland und auch seitens der Kommission bereits als restitutionswürdig anerkannte Fallkonstellationen, namentlich in Bezug auf sogenanntes Fluchtgut, also Zwangs- und Notverkäufe von NS-Verfolgten, weitgehend aus und ignoriert komplexe historische Umstände, unter denen Kulturgüter verloren gingen. Zudem könnte die geplante, gegenüber dem jetzigen Verfahren restriktiv ausgelegte Aktivlegitimation die Anspruchsdurchsetzung von Betroffenen immens erschweren. Auch der de facto weiterhin bestehende Zustimmungszwang – das sogenannte „stehende Angebot“ auf Verfahrensteilnahme einer kulturgutbewahrenden Einrichtung – beeinträchtigt die Effektivität des Verfahrens erheblich, da insbesondere kommunale Einrichtungen nicht zur Teilnahme verpflichtet werden können.
Trotz positiver Ansätze fatales Signal
Die Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Schiedsgerichts gibt ebenfalls Anlass zur Sorge. Einflussmöglichkeiten durch entsendende Institutionen und die begrenzte Auswahl unabhängiger Vertreter der Opfer könnten die Interessen der Institutionen über die der Opfer stellen. Einschränkungen wie Altersgrenzen oder beschränkte Amtszeiten könnten erfahrene Experten von der Mitarbeit ausschließen. Trotz einiger positiver Ansätze, wie der Lockerung der Beweislast, der Akzeptanz von Indizienbeweisen und der Anerkennung der Maßgeblichkeit der Eigentumsvermutung des § 1006 BGB, bleiben erhebliche Schwächen. Geboten ist und eingefordert wird daher unter anderem die Ausweitung des Anwendungsbereichs, die gesetzliche Verpflichtung öffentlicher Institutionen zur Teilnahme, eine stärkere Einbindung von Opferverbänden und unabhängigen Experten sowie die Förderung internationaler Kooperation. Nur durch solche Anpassungen kann Deutschland seine Glaubwürdigkeit in der globalen Restitutionspolitik bewahren und eine gerechte Aufarbeitung des NS-Unrechts gewährleisten.
Mit der Unterzeichnung des Washingtoner Abkommens hat sich Deutschland verpflichtet, NS-Unrecht aktiv zu korrigieren. Die jetzige Reform widerspricht diesem Anspruch. Sie signalisiert, dass der Schutz von institutionellen Besitzern über die Rechte der Opfer gestellt wird. Das ist ein fatales Signal sowohl für die Nachfahren der Geschädigten als auch für die internationale Gemeinschaft.
Dieser Inhalt ist zuerst in der NJW erschienen. Sie möchten die NJW kostenlos testen? Jetzt vier Wochen gratis testen inkl. Online-Modul NJWDirekt.