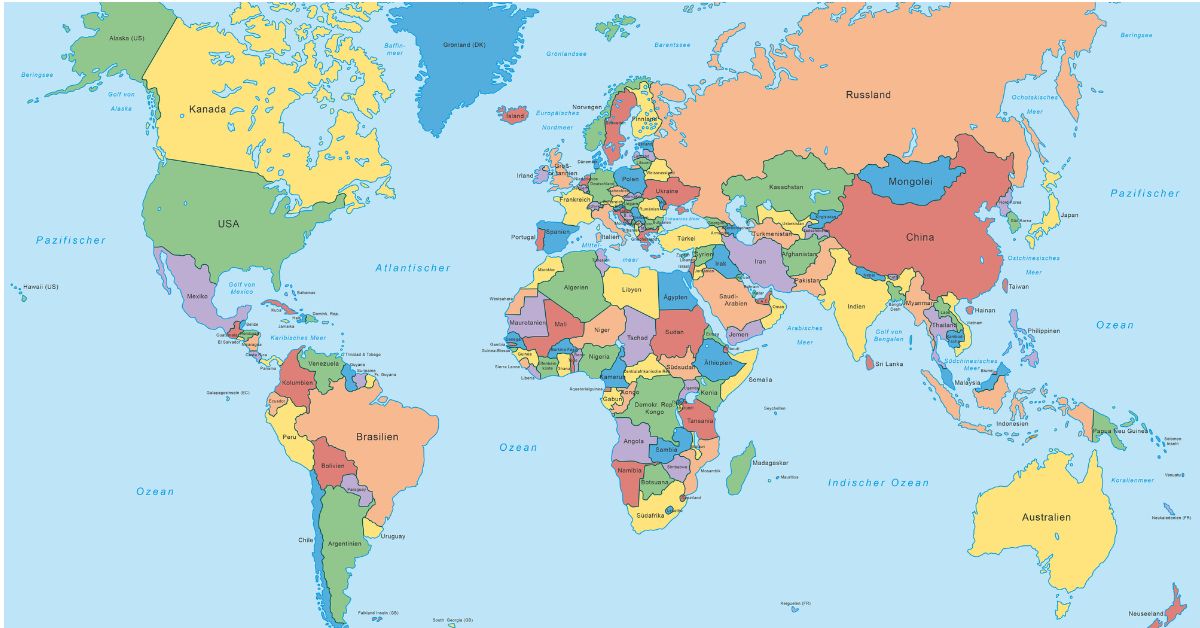Denn der Täter solcher Verbrechen wird als „hostis humani generis“ – ein Feind der gesamten Menschheit – gesehen, da seine Tat die gesamte Staatengemeinschaft betreffende Rechtsgüter verletzt hat (Maierhöfer, Aut dedere – aut iudicare, 2006, 40f). So wird Straflosigkeit verhindert und sichergestellt, dass sich die Täter nicht einfach durch Flucht in einen anderen Staat der Bestrafung entziehen können.
Maßgebliche „core crimes“
Das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) setzt die Verbrechenstatbestände des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in nationales Recht um. Das sind insbesondere der Völkermord (§ 6 VStGB), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 VStGB) und Kriegsverbrechen (§§ 8–12 VStGB), wobei das Weltrechtsprinzip in § 1 VStGB die Grundlage für die Strafverfolgung in Deutschland ist. Es bedarf keines „genuine link“ (vernünftigen Anknüpfungspunkts) zum Inland, um die Zuständigkeit zu begründen. Dies unterscheidet es von anderen Jurisdiktionsprinzipien im Strafanwendungsrecht wie dem Territorialitätsprinzip, dem Personalitätsprinzip oder dem Schutzprinzip.
Das Weltrechtsprinzip dient oft als Auffangnetz und letztes Mittel, wenn andere juristische Instanzen nicht funktionieren oder nicht zur Verfügung stehen. Im Falle Syriens beispielsweise konnten internationale Tribunale aufgrund politischer Blockaden im UN-Sicherheitsrat (insbesondere durch Russland und China) nicht tätig werden. Dadurch sind das Weltrechtsprinzip anwendende nationale Gerichte das einzig praktikable Instrument, um die Straflosigkeit für die „core crimes“ zu durchbrechen. Allerdings wird die Reichweite durch praktische Hindernisse wie Beweisschwierigkeiten, fehlende internationale Kooperation oder politische Sensibilitäten begrenzt. Außerdem ist der Generalbundesanwalt gem. § 153f StPO nicht zur Verfolgung jeder Völkerstraftat verpflichtet, sondern verfügt über einen Ermessensspielraum. Eine – gerichtlich nicht überprüfbare – Einstellung des Verfahrens ist möglich (Raube KriPoZ 2024, 278 [296]), wenn beispielsweise kein Tatverdacht gegen einen deutschen Staatsangehörigen besteht, die Tat nicht gegen einen Deutschen gerichtet war, der Tatverdächtige sich nicht im Inland aufhält oder ein solcher Aufenthalt nicht zu erwarten ist, oder die Tat bereits vor dem IStGH oder durch einen anderen Staat verfolgt wird.
Signal gegen Straflosigkeit
Insgesamt etablieren Verfahren wie der Al-Khatib-Prozess vor dem OLG Koblenz als weltweit erstes Verfahren wegen der durch das Assad-Regime verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auch das jüngst gegen Alaa M. vor dem OLG Frankfurt a.M. geführte Strafverfahren das Weltrechtsprinzip als ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen die Straflosigkeit für Völkerstraftaten (Raube KriPoZ 2024, 278 [279]). Sie haben internationale Beachtung gefunden, gelten als Meilensteine im Völkerrecht im Kampf gegen Straflosigkeit und unterstreichen die Rolle nationaler Justizsysteme bei der Durchsetzung des Völkerstrafrechts, wenn internationale Mechanismen versagen (Jessberger/Epik/Meloni 20 Jahre Völkerstrafgesetzbuch, 2023, S. 69). Natürlich ist nicht zu verkennen, dass die Verfahren sehr aufwendig und mühevoll sind. So dauerte der Prozess gegen Alaa M. fast dreieinhalb Jahre und umfasste 188 Verhandlungstage, was gegenüber dem Ruanda-Verfahren mit seinen 300 Hauptverhandlungstagen und Kosten von fünf Millionen EUR (vgl. Fesefeldt Legal Tribune Online v. 30.10.2018, https://www.lto.de/persistent/a_id/31789) fast schon bescheiden wirkt. Außerdem stoßen solche Verfahren immer an die strafprozessualen Grenzen, was beispielsweise auch den Zeugenschutz betrifft. Dennoch sollte dieser „Preis“ für das Weltrechtsprinzip als notwendig akzeptiert werden, um ein starkes Signal gegen Straflosigkeit gegen solche Geschehnisse zu senden, die mit den „core crimes“ des Völkerstrafrechts umschrieben werden.
Dieser Inhalt ist zuerst in der NJW erschienen. Sie möchten die NJW kostenlos testen? Jetzt vier Wochen gratis testen inkl. Online-Modul NJWDirekt.