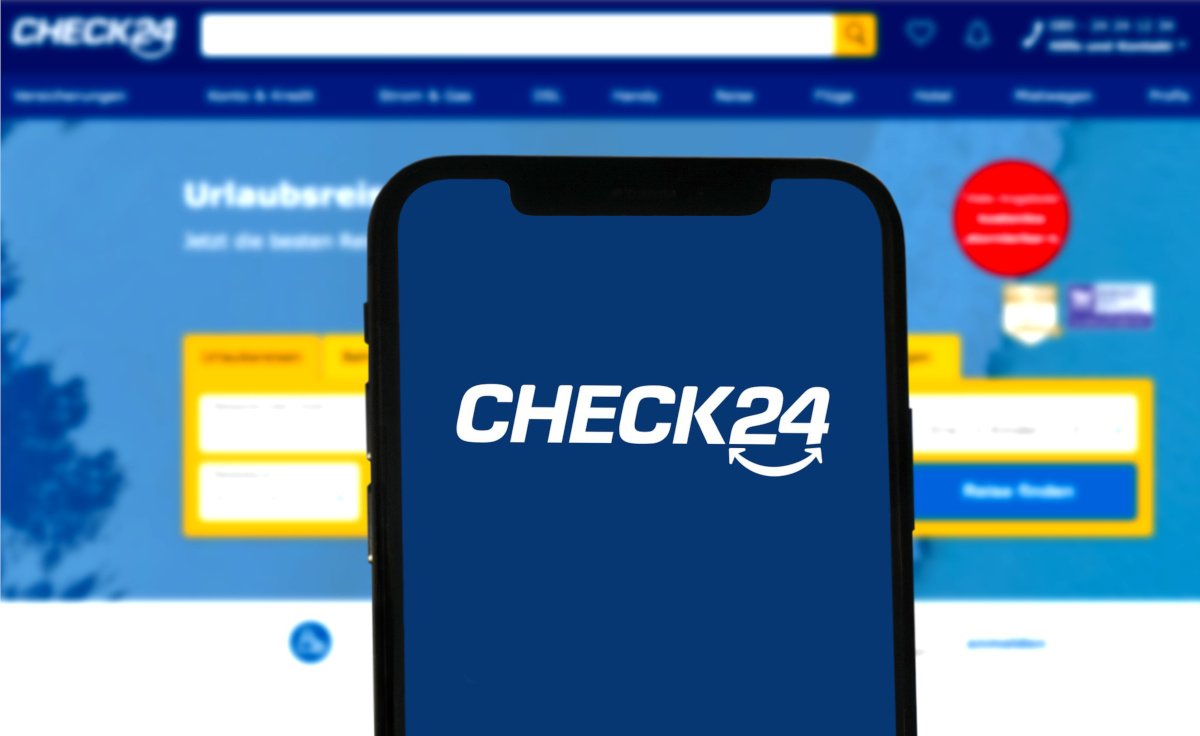Lost im Internet. Wer im Internet nach Waren oder Dienstleistungen sucht, könnte schier verzweifeln. Das Angebot ist riesengroß: Doch welchem „Testbericht“ kann man vertrauen? Welchen (echten oder gefakten) Kundenbewertungen? Auch auf ein namhaftes Vergleichsportal wie Check24 ist kein Verlass – das meint jedenfalls eine ebenfalls prominente Versicherungsgruppe. Die „HUK-COBURG Haftplicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands auf Gegenseitigkeit“ hat stellvertretend für ihre diversen Konzerntöchter die „Check24 Vergleichsportal GmbH“ samt deren Untergesellschaften für Kfz-, Sach-, Kranken- und Vorsorgeversicherungen sowie für „Versicherungsprodukte“ (gemeint sind Sterbegeldpolicen) vor das LG München I gezerrt. Sie hält deren Vergabe von Tarifnoten (von 1,0 bis 4,0, also „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“ oder „ausreichend“) für eine unzulässige vergleichende Werbung. Wenngleich die Zensuren auch von Angaben der Produktsuchenden abhängig sind, die sie im Internet eintragen müssen. Und obwohl die Assekuranz seit einer Niederlage vor dem LG Köln wegen § 6 II Nr. 2 UWG noch deutlich mehr Informationen zu ihren Bewertungen anzeigt.
Die Münchener Richter haben den EuGH gefragt, ob die Brüsseler Richtlinie „über irreführende und vergleichende Werbung“ (2006/114/EG) dieses Prozedere gestattet. Nach deren Artikel 4c) ist eine reklamehafte Gegenüberstellung unter anderem dann zulässig, wenn sie „objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann“, aufführt. Doch eine Kammer für Handelssachen in der Freistaat-Hauptstadt hat Zweifel, ob diese Erlaubnis auch dann gilt, „wenn der Vergleich mittels eines Benotungs- bzw. Bepunktungssystems durchgeführt wird“. Die Antwort wollen ihr die Europarichter am 8.5. erteilen.
Und sonst? Das BVerwG urteilt am 6.5., ob Wursthüllen und -clipse nach MessEG, FPackV und EU-LMIV zur Füllmenge gerechnet werden dürfen. Ein Eichamt hatte dies verboten – das OVG Münster sah das lockerer („Entscheidung der Woche“, NJW-aktuell H. 52/2024, 9). Der BFH befasst sich am 7.5. mit zwei Besonderheiten der Grunderwerbsteuer (§ 16 II GrEStG). Und nur in diesem Jahr ist (lediglich) in Berlin der 8.5. ein gesetzlicher Feiertag – der Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkriegs.
Dieser Inhalt ist zuerst in der NJW erschienen. Sie möchten die NJW kostenlos testen? Jetzt vier Wochen gratis testen inkl. Online-Modul NJWDirekt.