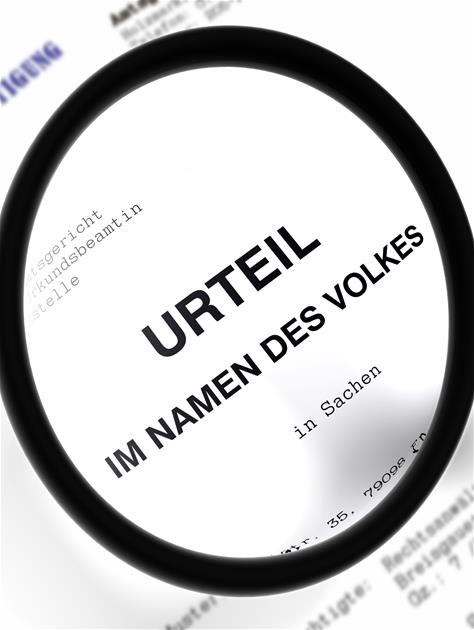Anmerkung von Rechtsanwalt Thomas C. Knierim, Knierim & Kollegen, Mainz
Aus beck-fachdienst Strafrecht 05/2023 vom 09.03.2023
Diese Urteilsbesprechung ist Teil des zweiwöchentlich erscheinenden Fachdienstes Strafrecht. Neben weiteren ausführlichen Besprechungen der entscheidenden aktuellen Urteile im Strafrecht beinhaltet er ergänzende Leitsatzübersichten und einen Überblick über die relevanten neu erschienenen Aufsätze. Zudem informiert er Sie in einem Nachrichtenblock über die wichtigen Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis des Strafrechts. Weitere Informationen und eine Schnellbestellmöglichkeit finden Sie unter www.beck-online.de.
Sachverhalt
Die Geschädigte (G) hatte gegenüber den Ermittlungsbehörden in mehreren Briefen darüber Beschwerde geführt, dass der Angeklagte (A) ihre Bankkarte (EC-Karte) eingesetzt habe, um Geld von ihrem Bankkonto abzuheben, das sie nicht erhalten habe. Einige Male zuvor habe sie zwar dem A für konkrete einzelne Abhebungen die Bankkarte jeweils ausgehändigt und ihm die Geheimnummer (PIN) mitgeteilt. Aber die Karte sei dann jeweils an die G zurückgegeben worden. In dem Geschehen, das Gegenstand der Anklage war, sollte der A die Karte ohne Absprache mit der G „an sich genommen“ haben, ob eine Rückgabe erfolgte, wurde nicht ausdrücklich festgestellt. Das AG verurteilte den A daraufhin wegen Computerbetruges. Die Berufungskammer des LG hielt die Verurteilung aufrecht und wertete strafschärfend, dass der A „einschlägig vorbestraft“ sei. Die Revision des A zum OLG war erfolglos.
Entscheidung
Die Revision wurde als unbegründet verworfen.
Für rechtlich bedenklich aber nicht durchgreifend erachtete der Senat, dass das LG in den Urteilsgründen den näheren Inhalt der Briefe der G nicht dargestellt hat, insbesondere weil damit unklar geblieben sei, ob die Berufungskammer Zweifel an deren Geisteszustand hatte. Indes würde – selbst wenn man hierin einen Rechtsfehler erblicken wollte – das angefochtene Urteil nicht auf einem solchen beruhen. Das LG habe seine Überzeugungsbildung erkennbar schon auf die übrigen – rechtsfehlerfrei festgestellten und erörterten Umstände – gestützt und die Briefe lediglich noch zur Abrundung am Ende seiner Beweiswürdigung erwähnt.
Das festgestellte Tatgeschehen erfülle auch den Straftatbestand des § 263a Abs. 1 StGB in der Alternative der unbefugten Verwendung von Daten. Unbefugt sei eine Verwendung von Daten auch dann, wenn eine Bankkarte verwendet werde, die mittels verbotener Eigenmacht erlangt worden sei. Hingegen wäre der Tatbestand der genannten Strafnorm nicht erfüllt, wenn die G dem A die Bankkarte nebst Geheimnummer überlassen und dieser lediglich abredewidrig (zu viel) Geld für eigene Zwecke am Geldautomaten abgehoben hätte, denn dies stünde einer erteilten Bankvollmacht gleich. In einem solchen Fall käme dann die Strafbarkeit nach § 266 StGB wegen Untreue in Betracht. Im vorliegenden Fall habe die G aber dem A weder generell noch für die konkreten Abhebungen die Bankkarte überlassen. Vielmehr habe es sich so verhalten, dass die G dem A in der Vergangenheit für konkrete einzelne Einkäufe die EC-Karte jeweils ausgehändigt und ihm die Geheimnummer kundgetan habe. Die Karte – das ergebe sich aus dem Gesamtzusammenhang der Urteilsgründe – sei dann jeweils zurück an die G ausgehändigt worden. Im konkreten Fall – so die Feststellungen – habe der A die Karte „an sich genommen“. Sie sei ihm also gerade nicht ausgehändigt worden.
In der Strafzumessung habe das LG strafschärfend gewertet, dass der A „auch einschlägig“ vorbestraft sei. Dies erscheine auf der Basis der getroffenen Feststellungen rechtsfehlerhaft, weil sich aus den Feststellungen zu den Vorstrafen keine einschlägigen ergeben.
Der Umstand, dass die Höhe des einzelnen Tagessatzes deutlich zu niedrig angesetzt worden sei, beschwere den A nicht. Das LG habe (u.a.) die vom A gezahlte monatliche Wohnungsmiete in Höhe von mehr als 500 EUR von seinem Nettoeinkommen abgezogen. Dies sei in zweifacher Hinsicht rechtlich zweifelhaft: Zum einen zahle der A nach den Feststellungen zur Person an seine Eltern nur in dem Zeitraum einen Mietzins, in dem diese sich nicht in Deutschland aufhalten, also nicht durchgängig ganzjährig. Zum anderen seien allgemeine Kosten der Lebenshaltung (Nahrungsmittel, Wohnen, Energie, Kleidung u.ä.) grundsätzlich nicht abziehbar. Wollte man auch solche in Abzug bringen, so würde die Geldstrafe als (spürbare) Strafsanktion entwertet, weil dann bestenfalls noch überdurchschnittliche (oder Luxus-) Konsummöglichkeiten eingeschränkt würden, der Täter aber ansonsten in seiner allgemeinen Lebensführung kaum betroffen wäre.
Praxishinweis
Angesichts einiger Untiefen der Entscheidungsgründe des 5. Strafsenats des OLG Hamm sollte der erste Leitsatz mit Vorsicht behandelt werden. Dem Leser erschließt sich jedenfalls aus den Entscheidungsgründen nicht, ob die dritte Tatbestandsalternative des § 263a Abs. 1 StGB („unbefugte Verwendung von Daten“) tatsächlich im Zeitpunkt der Tatausführung zweifelsfrei erfüllt war. Nicht dem Tatbestand des § 263a Abs. 1 StGB unterfällt eine Bankkartenverwendung, der kein täuschungsäquivalentes Verhalten innewohnt (BGH BeckRS 2004, 5411). Ob daher der Einsatz einer nicht für den Anwender persönlich ausgestellten Bankkarte einer Täuschung gleichgestellt werden kann, wäre zu klären gewesen. Die Entscheidungsgründe sind indessen dazu kaum aussagefähig. So lassen die Bemerkungen des Senats zur Frage, ob das LG Zweifel an der geistigen Gesundheit der Geschädigten ausgeräumt hatte, befürchten, dass die Fähigkeiten zu rechtstatsächlich selbstbestimmten Erklärungen der Bankkarteninhaberin, die mutmaßlich als einzige Belastungszeugin auftragt, nicht hinreichend geklärt wurden. Davon hing aber u.a. ab, ob die Verwendung der Bankkarte erlaubt oder durch Täuschung herbeigeführt war. Insbesondere angesichts des Vertrauensverhältnisses, das vom Senat durchaus konstatiert wurde, erscheint das Postulat einer „verbotenen Eigenmacht“ ohne nähere Feststellungen nicht überzeugend. Die Zweifel reichen von der Frage danach, wo und von wem die Bankkarte verwahrt wurde, ob der Angeklagte Mitbesitz hatte, bis hin zur Frage, ob der Einsatz der Bankkarte gegenüber der Bank überhaupt eine tatsächliche oder rechtsgeschäftliche Willensäußerung der Geschädigten erforderte. Nicht plausibel erscheint daher, dass in den Entscheidungsgründen dem vorangegangenen vertrauensvollen Umgang mit der Bankkarte ein nicht näher umschriebenes eigenmächtiges Verhalten gegenübergestellt wird. Zudem erschließt sich die von der herrschenden Meinung in Rspr. und Lit. geforderte betrugsähnliche Verhaltensweise des Besitzers der Bankkarte daraus nicht. Auch der Hinweis auf die zweite Entscheidung des BGH (BeckRS 2002, 867) trägt nicht. Zwar findet sich in dem dortigen Leitsatz ebenfalls das Postulat, dass die verbotene Eigenmacht das Tatbestandsmerkmal „unerlaubte Verwendung von Daten“ erfüllen kann. Aber die Ausfüllung dieses Tatbestandsmerkmals erfordert nicht lediglich die Feststellung einer Überschreitung einer Vertretungs- und Verfügungsmacht, wie der BGH ausdrücklich klarstellt. Zudem bedarf es der täuschungsbedingten Verwendung der Bankkarte, zu der man in den Entscheidungsgründen nichts vorfindet.
OLG Hamm, Beschluss vom 19.01.2023 - 5 RVs 39/22 (LG Essen), BeckRS 2023, 1671